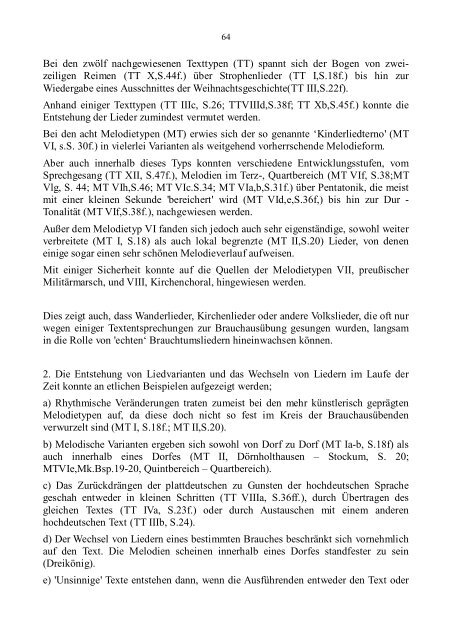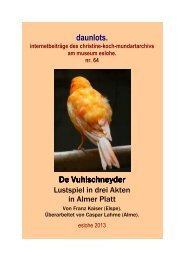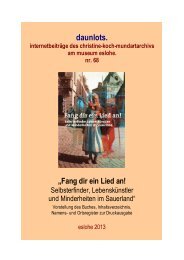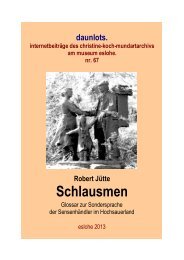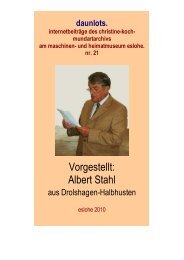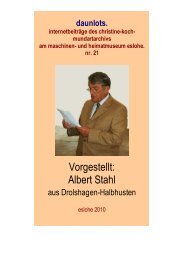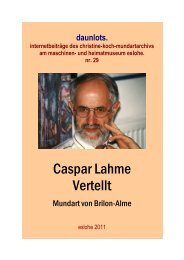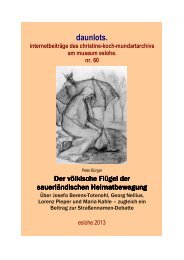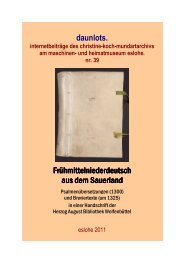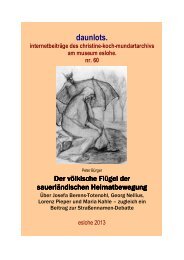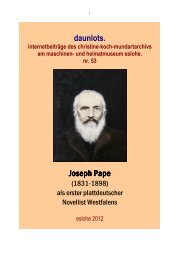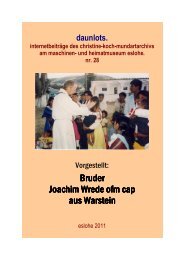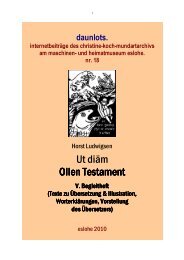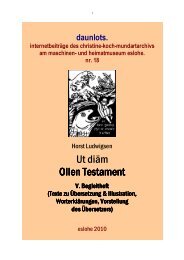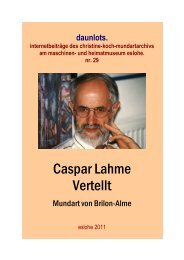Brauchtumslieder - Sauerlandmundart
Brauchtumslieder - Sauerlandmundart
Brauchtumslieder - Sauerlandmundart
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
64<br />
Bei den zwölf nachgewiesenen Texttypen (TT) spannt sich der Bogen von zweizeiligen<br />
Reimen (TT X,S.44f.) über Strophenlieder (TT I,S.18f.) bis hin zur<br />
Wiedergabe eines Ausschnittes der Weihnachtsgeschichte(TT III,S.22f).<br />
Anhand einiger Texttypen (TT IIIc, S.26; TTVIIId,S.38f; TT Xb,S.45f.) konnte die<br />
Entstehung der Lieder zumindest vermutet werden.<br />
Bei den acht Melodietypen (MT) erwies sich der so genannte ‘Kinderliedterno' (MT<br />
VI, s.S. 30f.) in vielerlei Varianten als weitgehend vorherrschende Melodieform.<br />
Aber auch innerhalb dieses Typs konnten verschiedene Entwicklungsstufen, vom<br />
Sprechgesang (TT XII, S.47f.), Melodien im Terz-, Quartbereich (MT VIf, S.38;MT<br />
Vlg, S. 44; MT VIh,S.46; MT VIc.S.34; MT VIa,b,S.31f.) über Pentatonik, die meist<br />
mit einer kleinen Sekunde 'bereichert' wird (MT VId,e,S.36f,) bis hin zur Dur -<br />
Tonalität (MT VIf,S.38f.), nachgewiesen werden.<br />
Außer dem Melodietyp VI fanden sich jedoch auch sehr eigenständige, sowohl weiter<br />
verbreitete (MT I, S.18) als auch lokal begrenzte (MT II,S.20) Lieder, von denen<br />
einige sogar einen sehr schönen Melodieverlauf aufweisen.<br />
Mit einiger Sicherheit konnte auf die Quellen der Melodietypen VII, preußischer<br />
Militärmarsch, und VIII, Kirchenchoral, hingewiesen werden.<br />
Dies zeigt auch, dass Wanderlieder, Kirchenlieder oder andere Volkslieder, die oft nur<br />
wegen einiger Textentsprechungen zur Brauchausübung gesungen wurden, langsam<br />
in die Rolle von 'echten‘ <strong>Brauchtumslieder</strong>n hineinwachsen können.<br />
2. Die Entstehung von Liedvarianten und das Wechseln von Liedern im Laufe der<br />
Zeit konnte an etlichen Beispielen aufgezeigt werden;<br />
a) Rhythmische Veränderungen traten zumeist bei den mehr künstlerisch geprägten<br />
Melodietypen auf, da diese doch nicht so fest im Kreis der Brauchausübenden<br />
verwurzelt sind (MT I, S.18f.; MT II,S.20).<br />
b) Melodische Varianten ergeben sich sowohl von Dorf zu Dorf (MT Ia-b, S.18f) als<br />
auch innerhalb eines Dorfes (MT II, Dörnholthausen – Stockum, S. 20;<br />
MTVIe,Mk.Bsp.19-20, Quintbereich – Quartbereich).<br />
c) Das Zurückdrängen der plattdeutschen zu Gunsten der hochdeutschen Sprache<br />
geschah entweder in kleinen Schritten (TT VIIIa, S.36ff.), durch Übertragen des<br />
gleichen Textes (TT IVa, S.23f.) oder durch Austauschen mit einem anderen<br />
hochdeutschen Text (TT IIIb, S.24).<br />
d) Der Wechsel von Liedern eines bestimmten Brauches beschränkt sich vornehmlich<br />
auf den Text. Die Melodien scheinen innerhalb eines Dorfes standfester zu sein<br />
(Dreikönig).<br />
e) 'Unsinnige' Texte entstehen dann, wenn die Ausführenden entweder den Text oder