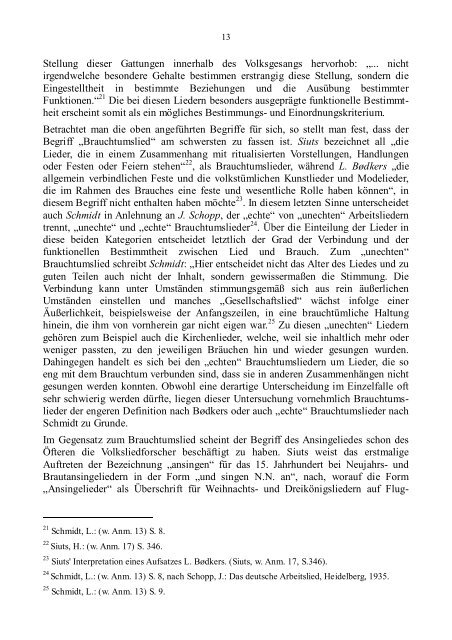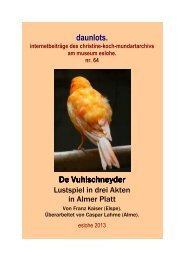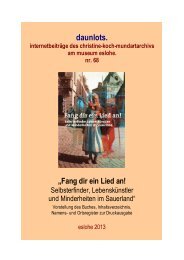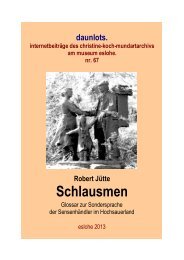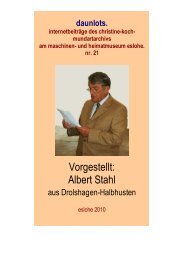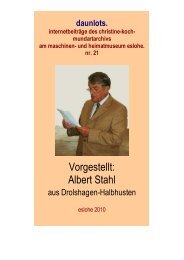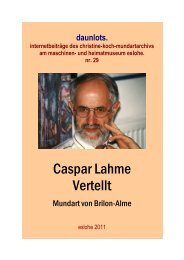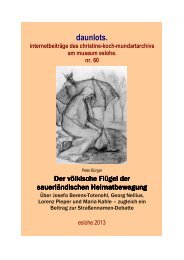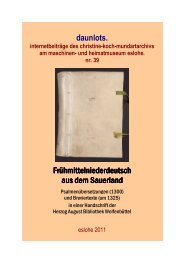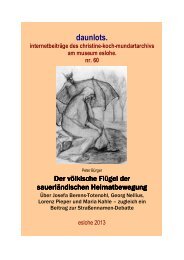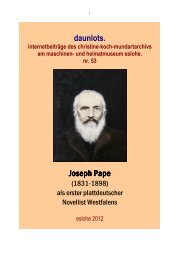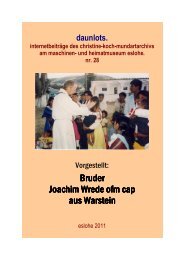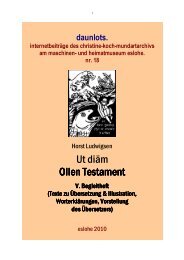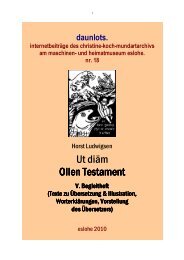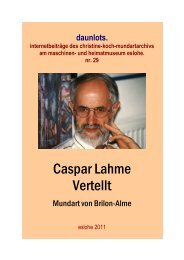Brauchtumslieder - Sauerlandmundart
Brauchtumslieder - Sauerlandmundart
Brauchtumslieder - Sauerlandmundart
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
13<br />
Stellung dieser Gattungen innerhalb des Volksgesangs hervorhob: „... nicht<br />
irgendwelche besondere Gehalte bestimmen erstrangig diese Stellung, sondern die<br />
Eingestelltheit in bestimmte Beziehungen und die Ausübung bestimmter<br />
Funktionen.“ 21 Die bei diesen Liedern besonders ausgeprägte funktionelle Bestimmtheit<br />
erscheint somit als ein mögliches Bestimmungs- und Einordnungskriterium.<br />
Betrachtet man die oben angeführten Begriffe für sich, so stellt man fest, dass der<br />
Begriff „Brauchtumslied“ am schwersten zu fassen ist. Siuts bezeichnet all „die<br />
Lieder, die in einem Zusammenhang mit ritualisierten Vorstellungen, Handlungen<br />
oder Festen oder Feiern stehen“ 22 , als <strong>Brauchtumslieder</strong>, während L. Bødkers „die<br />
allgemein verbindlichen Feste und die volkstümlichen Kunstlieder und Modelieder,<br />
die im Rahmen des Brauches eine feste und wesentliche Rolle haben können“, in<br />
diesem Begriff nicht enthalten haben möchte 23 . In diesem letzten Sinne unterscheidet<br />
auch Schmidt in Anlehnung an J. Schopp, der „echte“ von „unechten“ Arbeitsliedern<br />
trennt, „unechte“ und „echte“ <strong>Brauchtumslieder</strong> 24 . Über die Einteilung der Lieder in<br />
diese beiden Kategorien entscheidet letztlich der Grad der Verbindung und der<br />
funktionellen Bestimmtheit zwischen Lied und Brauch. Zum „unechten“<br />
Brauchtumslied schreibt Schmidt: „Hier entscheidet nicht das Alter des Liedes und zu<br />
guten Teilen auch nicht der Inhalt, sondern gewissermaßen die Stimmung. Die<br />
Verbindung kann unter Umständen stimmungsgemäß sich aus rein äußerlichen<br />
Umständen einstellen und manches „Gesellschaftslied“ wächst infolge einer<br />
Äußerlichkeit, beispielsweise der Anfangszeilen, in eine brauchtümliche Haltung<br />
hinein, die ihm von vornherein gar nicht eigen war. 25 Zu diesen „unechten“ Liedern<br />
gehören zum Beispiel auch die Kirchenlieder, welche, weil sie inhaltlich mehr oder<br />
weniger passten, zu den jeweiligen Bräuchen hin und wieder gesungen wurden.<br />
Dahingegen handelt es sich bei den „echten“ <strong>Brauchtumslieder</strong>n um Lieder, die so<br />
eng mit dem Brauchtum verbunden sind, dass sie in anderen Zusammenhängen nicht<br />
gesungen werden konnten. Obwohl eine derartige Unterscheidung im Einzelfalle oft<br />
sehr schwierig werden dürfte, liegen dieser Untersuchung vornehmlich <strong>Brauchtumslieder</strong><br />
der engeren Definition nach Bødkers oder auch „echte“ <strong>Brauchtumslieder</strong> nach<br />
Schmidt zu Grunde.<br />
Im Gegensatz zum Brauchtumslied scheint der Begriff des Ansingeliedes schon des<br />
Öfteren die Volksliedforscher beschäftigt zu haben. Siuts weist das erstmalige<br />
Auftreten der Bezeichnung „ansingen“ für das 15. Jahrhundert bei Neujahrs- und<br />
Brautansingeliedern in der Form „und singen N.N. an“, nach, worauf die Form<br />
„Ansingelieder“ als Überschrift für Weihnachts- und Dreikönigsliedern auf Flug-<br />
21 Schmidt, L.: (w. Anm. 13) S. 8.<br />
22 Siuts, H.: (w. Anm. 17) S. 346.<br />
23 Siuts' Interpretation eines Aufsatzes L. Bødkers. (Siuts, w. Anm. 17, S.346).<br />
24 Schmidt, L.: (w. Anm. 13) S. 8, nach Schopp, J.: Das deutsche Arbeitslied, Heidelberg, 1935.<br />
25 Schmidt, L.: (w. Anm. 13) S. 9.