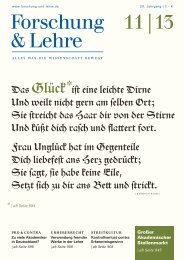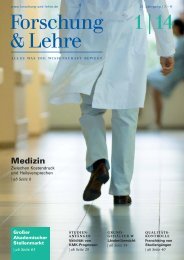12|13 Forschung & Lehre
12|13 Forschung & Lehre
12|13 Forschung & Lehre
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>12|13</strong> <strong>Forschung</strong> & <strong>Lehre</strong> FORSCHUNG 1017<br />
Hund und<br />
Mensch<br />
Europäische Jäger und<br />
Sammler haben als erste<br />
Menschen der Welt Hunde<br />
gehalten. Das belegt eine genetische<br />
Studie. Sie beendet<br />
die Diskussion um den Ursprung<br />
des Hundes, der lange<br />
Zeit in Ostasien vermutet<br />
wurde. Forscher von der finnischen<br />
Universität Turku<br />
verglichen das Erbgut moderner<br />
Hunde und Wölfe mit<br />
jenem von prähistorischen<br />
Tieren aus verschiedenen<br />
Erdteilen. Demnach stammen<br />
alle heute lebenden<br />
Hunde von europäischen<br />
Vorfahren ab. Eine Beziehung<br />
zu Wölfen außerhalb<br />
Europas sei hingegen nur<br />
entfernt vorhanden. Zudem<br />
untersuchten die Wissenschaftler<br />
den Zeitpunkt der<br />
Domestizierung. Demnach<br />
begann sie vor etwa 19 000<br />
bis 32 000 Jahren – zu einer<br />
Zeit, als Europa von Jägern<br />
und Sammlern bevölkert<br />
war. Vermutlich folgten die<br />
Wölfe den jagenden Menschen<br />
auf der Suche nach<br />
Aas und Nahrungsresten und<br />
gaben so den Anstoß zum<br />
späteren Zusammenleben.<br />
Damit widerspreche es der<br />
bisherigen Annahme, dass<br />
die Landwirtschaft Wölfe in<br />
die Dörfer lockte und dies<br />
zur anschließenden Domestizierung<br />
führte. Den Hund<br />
als Haustier hätte es gegeben,<br />
lange bevor zum Beispiel<br />
Ziegen, Schafe oder<br />
Rinder domestiziert wurden.<br />
Für ihre Studie analysierten<br />
die Forscher das Erbgut von<br />
18 prähistorischen Tieren,<br />
das von 77 modernen Hunden<br />
und das von 49 Wölfen.<br />
Dabei nutzten sie die DNA<br />
aus den Mitochondrien, die<br />
nur über die weibliche Linie<br />
weitergegeben wird und daher<br />
die Verwandtschaftsbeziehungen<br />
sehr genau abbildet<br />
(Olaf Thalmann et al.,<br />
DOI: 10. 1126/science.1243<br />
650; dpa, 18.11.13).<br />
Foto: picture-alliance<br />
Zecken<br />
Zecken bohren sich mit<br />
Bewegungen ähnlich denen<br />
von Brustschwimmern in<br />
die Haut von Menschen, um<br />
sich dort festzusaugen. Zuerst<br />
ritzen die Blutsauger mit<br />
ihren Kieferklauen die Haut<br />
an. Dann bohren sie ihren<br />
Unterkiefer mit den Widerhaken<br />
in Mensch oder Tier,<br />
um ihn dort fest zu verankern.<br />
Forscher der Charité<br />
und der Harvard Universität<br />
haben diesen Prozess mit<br />
Die Mikroskopaufnahme zeigt die Mundwerkzeuge eines Gemeinen<br />
Holzbocks.<br />
Transport auf künstlichen Eisbahnen<br />
Die Erbauer des Kaiserpalastes<br />
in China haben<br />
nach einer Studie riesige<br />
Steine per Schlitten auf<br />
künstlichen Eisbahnen transportiert.<br />
Allerdings waren in<br />
China, als die Verbotene<br />
Stadt vor etwa 600 Jahren in<br />
Peking errichtet wurde, Gefährte<br />
mit Speichenrädern<br />
schon seit 3 000 Jahren bekannt.<br />
Chinesische Ingenieure<br />
fanden nun heraus, welche<br />
Vorteile der Schlittentransport<br />
brachte. In einem Dokument<br />
aus der Bauphase fanden<br />
die Forscher einen Bericht<br />
über den Transport eines<br />
123 Tonnen schweren<br />
Steins. Mit einer besonderen<br />
Technik bewältigten die Arbeiter<br />
die 70 Kilometer lange<br />
Strecke vom Steinbruch bis<br />
nach Peking: Sie schütteten<br />
Wasser auf den eisigen Untergrund<br />
und ließen den<br />
Schlitten darüber gleiten. Um<br />
genügend Wasser zu haben,<br />
gruben sie alle 500 Meter einen<br />
Brunnen. Die Forscher<br />
Film- und Mikroskopaufnahmen<br />
beim Gemeinen Holzbock<br />
(Ixodes ricinus) genau<br />
untersucht. Der Vorgang<br />
dauere mehrere Minuten.<br />
Manchmal geht es auch<br />
schneller, schreiben die Wissenschaftler,<br />
wenn die Zecke<br />
ganz sicher sei, dass sie den<br />
richtigen Wirt gefunden habe.<br />
Dann verankere sich das<br />
Tier dort für etwa eine Woche,<br />
um Blut zu saugen –<br />
wenn es nicht vorher entdeckt<br />
und entfernt werde.<br />
Anders als oft vermutet sei es<br />
nicht gefährlich, wenn beim<br />
Entfernen einer Zecke ein<br />
Stück in der Haut steckenbleibe.<br />
Da breche das Hypostom<br />
ab, der mit Widerhaken<br />
versehene Unterkiefer. Davon<br />
gehe keine Gefahr aus,<br />
weil sich darin keine Erreger<br />
befänden (Dania Richter et<br />
al., DOI: 10.1098/rspb.2013.<br />
1758; dpa, 4.11.13).<br />
verglichen nun verschiedene<br />
Möglichkeiten, die aus der<br />
Antike bekannt sind, um einen<br />
123 Tonnen schweren<br />
Stein zu transportieren.<br />
Dann ermittelten sie anhand<br />
des jeweiligen Reibungskoeffizienten<br />
den geschätzten Bedarf<br />
an Männern, die den<br />
Schlitten zogen: Für einen<br />
Schlitten auf trockenem Untergrund<br />
wären es 1 537<br />
Männer gewesen, für einen<br />
Schlitten auf einem Wasserfilm<br />
mit einem Holzuntergrund<br />
immer noch 358 Männer.<br />
In einer ähnlichen Größenordnung<br />
liegt der Transport<br />
auf hartem Eis. Erst das<br />
ständige Bewässern des Eises<br />
führt zu einem Gleitfilm, der<br />
vermutlich nur 46 Männer<br />
für den Transport erforderlich<br />
machte. Eine große Rolle<br />
bei der Entscheidung für diese<br />
Transportmethode spielte<br />
den Experten zufolge auch<br />
die Witterung: Damals lag in<br />
Peking die Durchschnittstemperatur<br />
im Januar bei etwa<br />
minus 3,7 Grad. Bei dieser<br />
Temperatur gefriert Wasser<br />
nicht vollständig innerhalb<br />
von zwei Minuten. Diese<br />
Zeit reichte, um den<br />
Schlitten über die gerade bewässerte<br />
Stelle zu ziehen und<br />
auf dem Wasserfilm gleiten<br />
zu lassen. Weitere Gründe<br />
seien gewesen, dass laut einer<br />
Quelle die Obergrenze für einen<br />
Wagentransport damals<br />
bei etwa 95 Tonnen gelegen<br />
habe. Die Eisfläche sei zudem<br />
viel glatter als der holprige<br />
Transport auf einem Wagen,<br />
bei dem der Stein beschädigt<br />
werden konnte.<br />
Schließlich lasse sich der<br />
Schlitten auf Eis auch leichter<br />
lenken als auf rollenden<br />
Holzstämmen (Jiang Li et al.,<br />
DOI: 10.1073/pnas.1309319<br />
110; dpa 11.11.13).<br />
Vera Müller