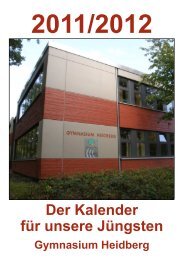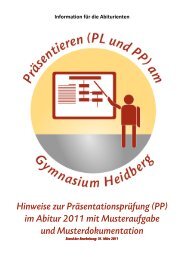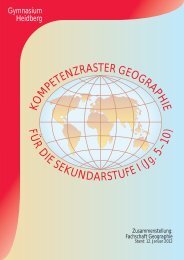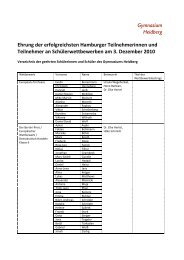Abitur 2014 » (PDF, 1,2 MB) - Hamburg
Abitur 2014 » (PDF, 1,2 MB) - Hamburg
Abitur 2014 » (PDF, 1,2 MB) - Hamburg
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Informatik<br />
<strong>Abitur</strong> <strong>2014</strong>: schriftliche Prüfung<br />
Zur Aufgabe 1:<br />
Objektorientierte Modellierung und Programmierung von Grafiksystemen<br />
Grundlegendes und erhöhtes Anforderungsniveau<br />
Die Schülerinnen und Schüler<br />
• modellieren einen Realitätsausschnitt objektorientiert, indem sie eine Beschreibung<br />
analysieren, Objekte identifizieren sowie deren Eigenschaften und Fähigkeiten<br />
angeben,<br />
• modellieren Beziehungen („hat-ein“/ „benutzt“, „ist-ein“) zwischen Objekten<br />
geeignet und begründen diese,<br />
• entwickeln ein Klassenmodell, indem sie Typen von Objekten als Klassen mit<br />
gemeinsamen Attributen und Methoden beschreiben und formal mit einem<br />
UML-Klassendiagramm visualisieren. Dabei geben sie auch geeignete Datentypen<br />
für Attribute und Methoden an und begründen diese,<br />
• erläutern bezüglich eines Modells die Kommunikation zwischen Objekten,<br />
• nutzen Sprachelemente wie elementare Datentypen, Sammlungsstrukturen (Python:<br />
Listen, Java: ArrayList) und Kontrollstrukturen von Python oder Java zur<br />
Implementation von Modellen syntaktisch korrekt,<br />
• erläutern gegebenen Quellcode mit Fachbegriffen (Attribut, Methode,<br />
Konstruktor, Parameter, Signatur, elementarer Datentyp, Objekttyp, Rückgabewert,<br />
Sichtbarkeit von Variablen, in Java: Zugriffsmodifikatoren) und modifizieren<br />
ihn zielgerichtet.<br />
Zusätzliche Anforderungen im erhöhten Niveau<br />
Die Schülerinnen und Schüler<br />
• erkennen, nutzen und vergleichen Klassenbeziehungen (einfache Assoziation,<br />
Aggregation und Komposition),<br />
• erläutern Sichtbarkeit von Variablen und Methoden, auch unter Einbeziehung<br />
abstrakter Klassen,<br />
• erläutern an vorgegebenen Beispielen das Konzept der Polymorphie,<br />
• bewerten ein Modell hinsichtlich Kohäsion und Kopplung.<br />
Zur Aufgabe 2: Datensicherheit in verteilten Systemen<br />
Grundlegendes und erhöhtes Anforderungsniveau<br />
Die Schülerinnen und Schüler<br />
• analysieren und beschreiben kommunikative Vorgänge mit Modellen (Client-<br />
Server-Modell, Schichtenmodell, Netztopologie, Protokoll) fachsprachlich korrekt,<br />
• analysieren Fallbeispiele und geben eine auf die jeweils relevanten Stellen der<br />
Gesetzestexte (Datenschutzgesetze, IuKDG) bezogene, begründete Einschätzung<br />
ab,<br />
• beschreiben Verfahren zur Sicherung von Vertraulichkeit, Integrität und Authentizität<br />
von Kommunikation,<br />
• unterscheiden monoalphabetische und polyalphabetische, symmetrische und<br />
asymmetrische Verschlüsselungsverfahren und wenden diese zur Chiffrierung<br />
und Dechiffrierung von Daten an,<br />
104