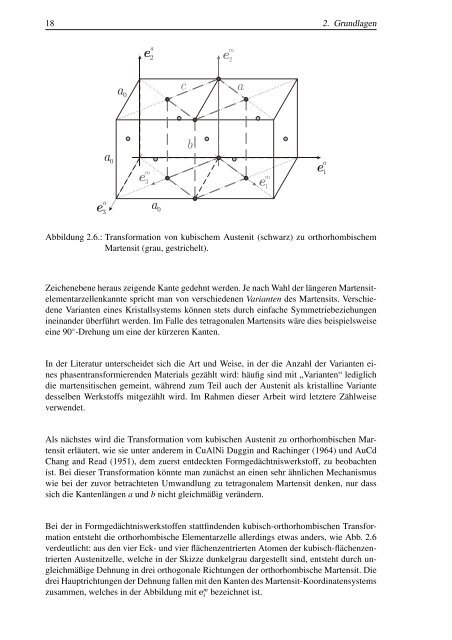Mikromechanische Modellierung von Formgedächtnismaterialien
Mikromechanische Modellierung von Formgedächtnismaterialien
Mikromechanische Modellierung von Formgedächtnismaterialien
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
18 2. Grundlagen<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Abbildung 2.6.: Transformation <strong>von</strong> kubischem Austenit (schwarz) zu orthorhombischem<br />
Martensit (grau, gestrichelt).<br />
Zeichenebene heraus zeigende Kante gedehnt werden. Je nach Wahl der längeren Martensitelementarzellenkannte<br />
spricht man <strong>von</strong> verschiedenen Varianten des Martensits. Verschiedene<br />
Varianten eines Kristallsystems können stets durch einfache Symmetriebeziehungen<br />
ineinander überführt werden. Im Falle des tetragonalen Martensits wäre dies beispielsweise<br />
eine 90 ◦ -Drehung um eine der kürzeren Kanten.<br />
In der Literatur unterscheidet sich die Art und Weise, in der die Anzahl der Varianten eines<br />
phasentransformierenden Materials gezählt wird: häufig sind mit „Varianten“ lediglich<br />
die martensitischen gemeint, während zum Teil auch der Austenit als kristalline Variante<br />
desselben Werkstoffs mitgezählt wird. Im Rahmen dieser Arbeit wird letztere Zählweise<br />
verwendet.<br />
Als nächstes wird die Transformation vom kubischen Austenit zu orthorhombischen Martensit<br />
erläutert, wie sie unter anderem in CuAlNi Duggin and Rachinger (1964) und AuCd<br />
Chang and Read (1951), dem zuerst entdeckten Formgedächtniswerkstoff, zu beobachten<br />
ist. Bei dieser Transformation könnte man zunächst an einen sehr ähnlichen Mechanismus<br />
wie bei der zuvor betrachteten Umwandlung zu tetragonalem Martensit denken, nur dass<br />
sich die Kantenlängen a und b nicht gleichmäßig verändern.<br />
Bei der in Formgedächtniswerkstoffen stattfindenden kubisch-orthorhombischen Transformation<br />
entsteht die orthorhombische Elementarzelle allerdings etwas anders, wie Abb. 2.6<br />
verdeutlicht: aus den vier Eck- und vier flächenzentrierten Atomen der kubisch-flächenzentrierten<br />
Austenitzelle, welche in der Skizze dunkelgrau dargestellt sind, entsteht durch ungleichmäßige<br />
Dehnung in drei orthogonale Richtungen der orthorhombische Martensit. Die<br />
drei Hauptrichtungen der Dehnung fallen mit den Kanten des Martensit-Koordinatensystems<br />
zusammen, welches in der Abbildung mit e m i bezeichnet ist.