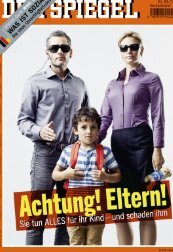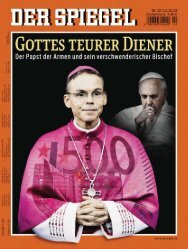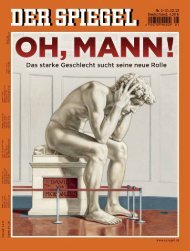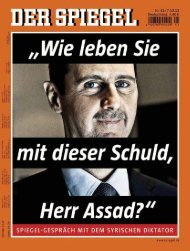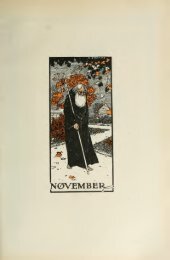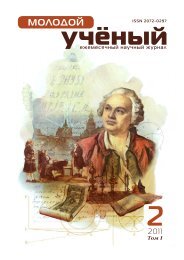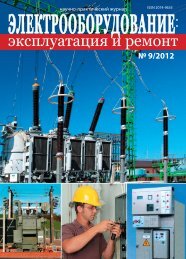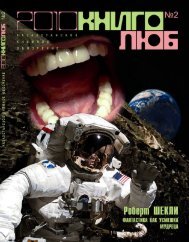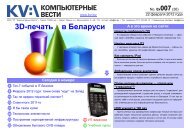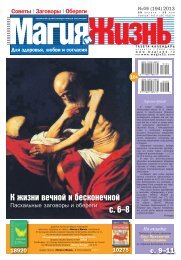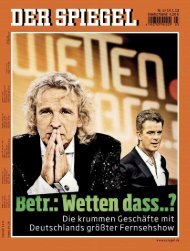Das Magazin für Funk Elektronik · Computer
Das Magazin für Funk Elektronik · Computer
Das Magazin für Funk Elektronik · Computer
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Bild 2: Leitungsführung der Platine <strong>für</strong> den IR-Repeater <strong>für</strong> Fernbedienungen<br />
von HiFi-Anlagen<br />
V4 schaltet. Es braucht nach dieser Schaltungsbeschreibung<br />
sicherlich nicht erläutert<br />
zu werden, daß damit das neu erzeugte<br />
IR-Signal genau dem am Empfängereingang<br />
entspricht.<br />
Zusätzlich ist noch ein Spannungsregler<br />
vorhanden, der die Betriebsspannung stabilisiert.<br />
Die Bilder 2 und 3 zeigen Platinenlayout<br />
und Bestückungsplan. Da die SFH 505 und<br />
SFH 506 unterschiedliche Anschlußbelegungen<br />
(Bild 1) besitzen, wurde auf der<br />
Platine eine Bestückungsmöglichkeit <strong>für</strong><br />
beide Typen vorgesehen. Nichtbesitzer<br />
von Oszilloskop oder Frequenzzähler sollten<br />
IC1 und R5 erst nach dem Abgleich bestücken.<br />
■ Inbetriebnahme<br />
Nach dem Bestücken der Bauelemente und<br />
einem optischen Test auf eventuelle Lötbrücken<br />
können wir den Abgleich durchführen.<br />
Er beschränkt sich auf die Einstellung<br />
der Trägerfrequenz. Als Meßgeräte<br />
benötigen wir ein Oszilloskop oder einen<br />
Frequenzzähler. Wir messen entweder Generatorfrequenz,<br />
die beim RC5-Kode, wie<br />
bereits bemerkt, 2304 kHz betragen muß,<br />
oder die Trägerfrequenz, die 1/64 der Generatorfreuenz<br />
(beim RC5-Kode die besagten<br />
36 kHz) beträgt.<br />
Der Abgleich erfolgt an R7. Bei zu hohen<br />
Bauelementetoleranzen kann der Abgleich<br />
schwierig sein. Für R7 und C3 können in<br />
diesem Fall andere Werte (oder einfach<br />
nochmal nach den gleichen Werten in die<br />
Bastelkiste greifen) gewählt werden.<br />
Für denjenigen, der weder Oszilloskop<br />
noch Frequenzzähler besitzt, gibt es dennoch<br />
eine einfache Abgleichmöglichkeit.<br />
Wir verwenden das Empfängerbauelement<br />
IC1 und bauen damit eine Empfängerschaltung<br />
auf einer Universalleiterplatte<br />
auf. An den Ausgang schließen wir einen<br />
einfachen Vielfachmesser an. Auf unserer<br />
eigentlichen Leiterplatte wird der jetzt<br />
noch freie Eingang (R1/C2) auf L gelegt.<br />
Die IR-Diode V4 sendet jetzt die Trägerfrequenz.<br />
Sie wird von unserem Empfänger<br />
auf der Universalleiterplatte demoduliert.<br />
Wir drehen danach so lange am Trimmwiderstand,<br />
bis wir die beiden Grenzwerte<br />
(niedrige und hohe Frequenz, bei denen<br />
der Empfängerausgang den Pegel wechselt)<br />
ermittelt haben. Die zugehörigen<br />
Stellungen des Trimmwiderstandes merken<br />
wir uns durch einen kleinen Bleistiftstrich<br />
und stellen ihn dann etwa auf die<br />
Mitte zwischen beiden Positionen ein. <strong>Das</strong><br />
Verfahren ist zwar nicht genau, dürfte<br />
jedoch <strong>für</strong> die Praxis genügen.<br />
Bei dieser Messung gibt es allerdings ein<br />
kleines Problem: Die IR-Diode sendet<br />
Praktische <strong>Elektronik</strong><br />
Bild 3: Der Bestückungsplan zeigt auch die Verwendung unterschiedlicher<br />
IR-Empfängerbauelemente<br />
Bild 4:<br />
<strong>Das</strong> Gehäuse kann<br />
auf die Platinenmaße<br />
gekürzt werden.<br />
ununterbrochen ohne die sonst zwischen<br />
den Datenburst auftretenden Pausen. Damit<br />
werden natürlich die Grenzwerte <strong>für</strong> die<br />
Diode und den Transistor schnell überschritten,<br />
und sie werden ziemlich warm.<br />
Während dieser Art des Frequenzabgleichs<br />
sollten wir den Strombegrenzungswiderstand<br />
R5 durch einen höheren Wert von<br />
z. B. 100 Ω ersetzen. Er kann aber anschließend<br />
wieder gegen den 1,2-Ω-Widerstand<br />
ausgetauscht werden.<br />
■ Gehäuse<br />
Es empfiehlt sich die Verwendung eines<br />
durchsichtigen Gehäuses (Bild 4), wie es im<br />
Fachhandel erhältlich ist. Diese Gehäuse<br />
sind zwar nicht unbedingt preiswert, aber<br />
man möchte doch auch einmal seine <strong>Elektronik</strong><br />
„richtig“ zeigen. Und wer nicht ständig<br />
an die vielleicht noch unvollkommenen<br />
Lötstellen erinnert werden möchte, kann die<br />
gleiche Gehäuseart in der schwarzen IRdurchlässigen<br />
Variante verwenden.<br />
Der entscheidende Vorteil dieser Gehäuse<br />
ist, daß IR-Sender und -Empfänger den besten<br />
„Rundumblick“ haben und somit<br />
kaum Einschränkungen der Strahlrichtung<br />
bestehen. Ein weiterer Vorteil dieser Gehäuseart<br />
ist, daß sie sich relativ einfach<br />
mit amateurmäßigen Mitteln auf die gewünschte<br />
Länge kürzen läßt.<br />
■ Stromversorgung<br />
Zur Stromversorgung eignet sich ein handelsübliches<br />
Steckernetzteil, das eine nicht<br />
stabilisierte Gleichspannung von etwa 7 bis<br />
9 V liefert. Dabei ist selbstverständlich auf<br />
die Polung zu achten. Notfalls können die<br />
im Handel erhältlichen Adapterstücke zum<br />
Wechsel der Polarität eingesetzt werden. Im<br />
übrigen kann das Gerät bei einer Falschpolung<br />
auch nicht zerstört werden; V5 läßt<br />
nur Betrieb mit der richtigen Polarität zu.<br />
Der Aufbau ist problemlos möglich, wodurch<br />
das Projekt auch <strong>für</strong> Einsteiger geeignet<br />
ist. Und wie gezeigt wurde, sind trotz<br />
notwendiger Abgleicharbeiten kaum Meßmittel<br />
erforderlich.<br />
FA 6/95 • 617