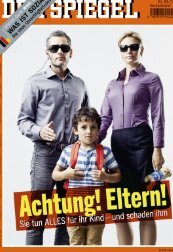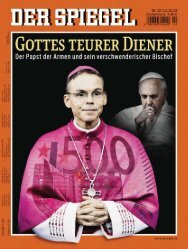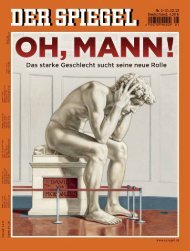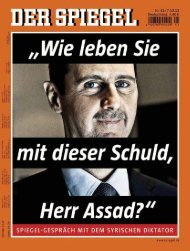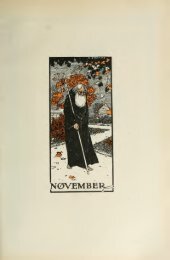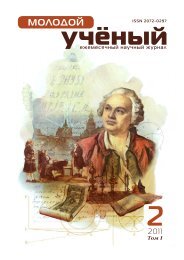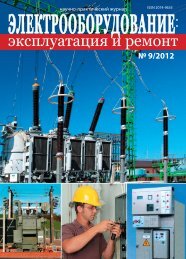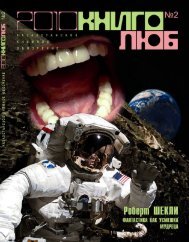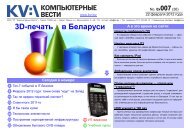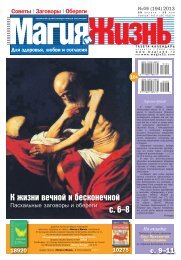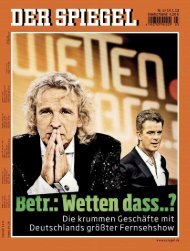Das Magazin für Funk Elektronik · Computer
Das Magazin für Funk Elektronik · Computer
Das Magazin für Funk Elektronik · Computer
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Einfacher Direktmischempfänger<br />
mit dem TDA 7000<br />
Ing. FRANK SICHLA – DL7VFS<br />
Die artfremde Nutzung eines bestimmten Dinges fasziniert kreative Geister<br />
seit eh und je – in der Amateurelektronik gibt es nicht wenige unkonventionelle<br />
Schaltkreisanwendungen, die das bestätigen. Hier sei in Form<br />
einer einfachen Empfängerschaltung eine weitere Variante hinzugefügt.<br />
Der bekannte UKW-Einchipempfänger<br />
TDA 7000 bietet aufgrund seiner etwas<br />
ungewöhnlichen internen Struktur auch die<br />
Möglichkeit, mit wenig Zusatzaufwand<br />
einen KW-Direktmischempfänger aufzubauen.<br />
Hierbei werden die Baugruppen<br />
Mischer und ZF-Verstärker voll genutzt.<br />
■ Spulenwickeln entfällt<br />
Wie das Bild zeigt, wird das Eingangssignal<br />
über eine SFET-Impedanzwandlerstufe<br />
unsymmetrisch an den Mischer gekoppelt.<br />
Die Signalspannung läßt sich daher<br />
am Hochpunkt des Eingangskreises<br />
auskoppeln, was ohne den SFET wegen<br />
der geringen Eingangsimpedanz des Mischers<br />
nicht möglich wäre. Somit kann eine<br />
Festinduktivität verwendet werden.<br />
Obwohl der multiplikativ arbeitende Mischer<br />
doppelsymmetrisch aufgebaut ist,<br />
erweist er sich als nicht besonders großsignalfest.<br />
<strong>Das</strong> verwundert nicht, denn <strong>für</strong><br />
die eigentliche Anwendung genügen mittlere<br />
Ansprüche an den Mischer, so daß<br />
seine Performance zum Preis einer sehr<br />
niedrigen Stromaufnahme herabgesetzt<br />
wurde. Eine Auslegung zum Empfang im<br />
80- oder 40-m-Band bringt daher keine<br />
befriedigenden Ergebnisse, so daß ich<br />
die Schaltung <strong>für</strong> das relativ „ruhige“<br />
30-m-Band dimensioniert habe. Die „Dosierung“<br />
der HF-Eingangsspannung mit<br />
einem niederohmigen Potentiometer gleich<br />
10 n<br />
33<br />
(18)<br />
G D<br />
S (1)<br />
Ant.<br />
BF 256 C<br />
470<br />
A1<br />
1 … 2<br />
TDA 7 000<br />
Wdg.<br />
(Pin 1… 4, 15,<br />
100<br />
lin. 3,3 μH 56<br />
17, 18 frei)<br />
35<br />
2x700<br />
10 n<br />
10 n<br />
am Eingang erweist sich auch hier als<br />
nützlich.<br />
Die Betriebsgüte des Eingangskreises hängt<br />
von der Güte der Festinduktivität und von<br />
der Ankopplung der Antenne über das<br />
Potentiometer ab. Bereits bei mäßig aufgedrehtem<br />
Potentiometer wird die Belastung<br />
praktisch minimal, was bis zum Anschlag<br />
<strong>für</strong> maximale Eingangsspannung<br />
der Fall bleibt. Es lohnt sich, den Koppelgrad<br />
praktisch zu erproben. Im Muster<br />
genügte bereits eine bügelartige Windung<br />
über der Festinduktivität, um die Spannung<br />
an der Source gegenüber der Eingangsspannung<br />
um 26 dB anzuheben (10 MHz).<br />
Maximale Transformation bedeutet maximale<br />
Betriebsgüte.<br />
Der Oszillator wird mit einer Kapazitätsdiode<br />
abgestimmt (Bezug: Tennert-<strong>Elektronik</strong>).<br />
Es eignen sich natürlich auch<br />
ähnliche Typen. Die Schaltung entspricht<br />
grundsätzlich der Hersteller-Applikation.<br />
Auch hier kommt eine handelsübliche<br />
Festinduktivität zum Einsatz. Die Katode<br />
der Abstimmdiode liegt an der stabilisierten<br />
Spannung von 5 V.<br />
Man dreht den Schleifer des Abstimmpotentiometers<br />
an Masse und stellt mit<br />
dem Trimmer die Bandende-Frequenz ein,<br />
bringt danach den Schleifer in die andere<br />
Anschlagposition und legt mit dem Einstellwiderstand<br />
die untere Empfangsfrequenz<br />
fest.<br />
Mischer<br />
Oszillator<br />
4,7 μH<br />
10 n<br />
6,8 n 10 n<br />
6,8 n<br />
BB 405 B<br />
35<br />
ZF<br />
10 n<br />
ZF<br />
100 n<br />
100 n<br />
100 μ<br />
47 k<br />
log.<br />
47 k 10 k<br />
3 1<br />
78L05<br />
lin.<br />
2<br />
10 n 10 n<br />
100 n<br />
47<br />
Amateurfunktechnik<br />
■ NF-Selektion ganz einfach<br />
Der interne ZF-Verstärker des TDA 7000<br />
besteht aus zwei Stufen, die normalerweise<br />
als Tiefpässe mit etwa 100 kHz Eckfrequenz<br />
arbeiten. Verdreißigfacht man die<br />
externen Kapazitäten, entsteht ein NF-Verstärker<br />
mit etwa 3,3 kHz Bandbreite. <strong>Das</strong><br />
habe ich hier in die Tat umgesetzt, so daß<br />
der TDA 7000 bereits eine etwa 300fache<br />
NF-Verstärkung erbringt. Ab etwa 5 mV<br />
Eingangsspannung (an Pin 13) beginnt die<br />
zweite Stufe des internen Verstärkers zu<br />
begrenzen.<br />
Infolge der hohen Verstärkung des Empfänger-Schaltkreises<br />
A1 braucht der als<br />
CW-Filter geschaltete Operationsverstärker<br />
A2 nur noch in geringem Maße zur<br />
NF-Verstärkung beizutragen. Sie erreicht<br />
bei etwa 800 Hz mit 20 dB ihr Maximum.<br />
Der Kopfhörer darf mittel- bis hochohmig<br />
sein.<br />
Die Schaltung läßt sich leicht auf einer<br />
Universalplatine (entweder nur Lochraster<br />
oder mit Einzel-Lötaugen) aufbauen. Als<br />
Kapazitätsdiode kommen z. B. auch die<br />
Typen BA 121, BA 138 bis BA 142,<br />
BA 161 und 162, BB 102, BB 117,<br />
BB 122, BB 125 und BB 141 B in Betracht.<br />
Diese Hinweise nur deshalb, weil<br />
man <strong>für</strong> KW geeignete Kapazitätsdioden<br />
relativ schlecht bekommt.<br />
Der Betrieb sollte mit einer 9-V-Blockbatterie<br />
erfolgen. Von Lautsprecherbetrieb<br />
wird wegen der Selbsterregungsgefahr abgeraten.<br />
Auch mit einer Hilfsantenne dürfte<br />
dieser Empfänger befriedigend funktionieren.<br />
Eine Auslegung <strong>für</strong> höhere Frequenzen<br />
ist grundsätzlich möglich, verlangt aber<br />
eine andere HF-Vorstufenschaltung.<br />
Abschließend sei nochmals darauf hingewiesen,<br />
daß dieser Direktmisch-RX zwar<br />
sehr einfach und empfindlich, aber auch relativ<br />
anfällig bezüglich Kreuz- und Intermodulation<br />
ist.<br />
100 μ<br />
10 μ<br />
10 k<br />
A2<br />
TAA 761<br />
1<br />
2<br />
+ 6<br />
3<br />
-<br />
4<br />
56<br />
5<br />
6,8 n 100 k<br />
10 k<br />
10 n<br />
10 n<br />
10 n<br />
9 V<br />
x<br />
1 N 4 001 max. 20 mA<br />
(ohne Kopfh.)<br />
10 n<br />
18 k 9,1 k 18 k<br />
Kompletter Stromlaufplan des Direktmisch-Empfängers <strong>für</strong> 10 MHz. Die großzügige Darstellung von A1 erleichtert das Verständnis<br />
der Schaltung.<br />
10 n<br />
BH<br />
FA 6/95 • 635