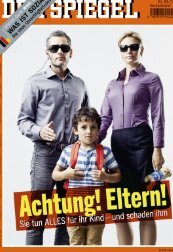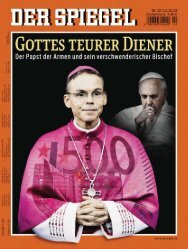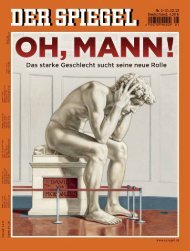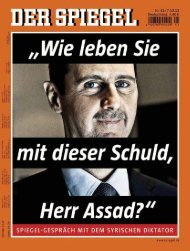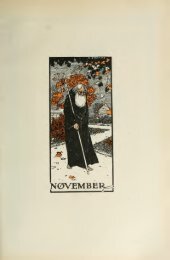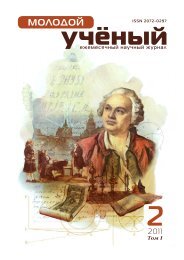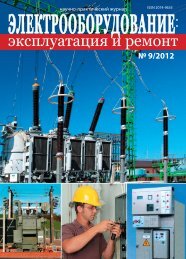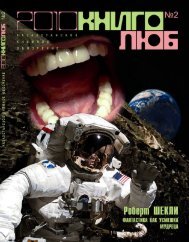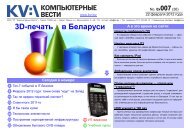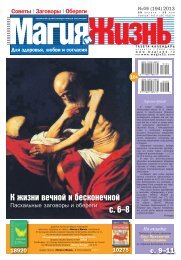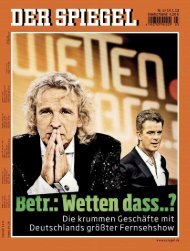Das Magazin für Funk Elektronik · Computer
Das Magazin für Funk Elektronik · Computer
Das Magazin für Funk Elektronik · Computer
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Koaxialkabel<br />
vom<br />
Sender<br />
(R1 = 50 Ω)<br />
dials (R E etwa 15 Ω) und angenommenen<br />
zusätzlichen Verlusten von R V = etwa 3 Ω<br />
(Verlängerungsspule, Anpaßnetzwerk usw.)<br />
hat einen Wirkungsgrad von nur etwa 24 %!<br />
Wie leicht einzusehen ist, würde eine Verbesserung<br />
des Erdnetzes schon einige Dezibel<br />
im Fernfeld bringen, aber der Aufwand<br />
ist relativ hoch. Vergraben Sie doch mal<br />
4 km ausgerollten Draht im Erdboden...<br />
Dies entspräche 100 Radials. Hier setzen<br />
nun Überlegungen an, die bei geringerem<br />
Aufwand wesentliche Verbesserungen<br />
bringen. Sie basieren auf den Messungen<br />
von W2FMI und berücksichtigen auch<br />
andere Erkenntnisse.<br />
■ T-Antenne von DJ8WL und DL9KR<br />
Zusammen mit meinem Freund Jan,<br />
DL9KR, entwickelte ich Mitte der 80er<br />
Jahre eine verbesserte T-Antenne, die in<br />
hohem Maß zum Erreichen des WAZ<br />
160 m beitrug. Wie aus der Literatur [2] zu<br />
entnehmen ist, vermag eine optimale Gestaltung<br />
des sogenannten „Toploading“ bei<br />
einer sehr kurzen Vertikalantenne den Fußpunktwiderstand<br />
fast zu vervierfachen!<br />
Dies allein kann beinahe schon eine S-Stufe<br />
ausmachen. Bei einer 18 m hohen Vertikal<br />
wird immerhin noch ein Faktor von ungefähr<br />
3,2 beim Fußpunktwiderstand erreicht.<br />
Im obigen Beispiel ergibt dies etwa 3 dB<br />
Signalzuwachs im Fernfeld.<br />
An dieser Stelle sei eine kurze Betrachtung<br />
zum Thema „Anpassung an 50 Ω“ eingefügt.<br />
Sie wird zeigen, daß es angebracht ist,<br />
die Antenne mit „Toploading“ um einen bestimmten<br />
Betrag „elektrisch länger“ zu machen,<br />
als es <strong>für</strong> Viertelwellenresonanz erforderlich<br />
ist. Die Anpassung soll mit einem<br />
aus der Literatur hinreichend bekannten,<br />
transformierenden L/C-Glied (Bild 1) erfolgen:<br />
Die <strong>für</strong> Amateure in der Praxis anwendbaren<br />
vereinfachten Formeln lauten:<br />
CP<br />
XLR = R .<br />
1 RA – R 2<br />
√<br />
A<br />
mit XLR = 2 π f LR und<br />
LR<br />
Antenne<br />
(50 Ω)<br />
Bild 1: Transformierendes L/C-Glied<br />
Koaxialkabel<br />
16,5 m 16,5 m<br />
18,0 m<br />
2,4n<br />
Erdsystem<br />
Bild 2: Prinzip der T-Antenne<br />
X CP =<br />
Mittels <strong>Computer</strong>programms durchgerechnete<br />
Werte <strong>für</strong> verschiedene R A im<br />
Bereich von 15 bis 35 Ω ergaben einen<br />
relativ „konstanten“ Wert von 2,0 bis 2,2<br />
µH. Der Wert <strong>für</strong> den Parallelkondensator<br />
bewegt sich dabei zwischen 1200...2700<br />
pF (siehe dazu auch Bild 3; gültig <strong>für</strong><br />
160 m!). Der Kondensator braucht keine<br />
besonders hohe Spannungsfestigkeit, sollte<br />
aber „Strom“ vertragen (z. B. Glimmer-<br />
Kondensator). Die nur relativ wenig<br />
schwankende Induktivität der Spule erlaubt<br />
nun den Trick, die (verlustbehaftete)<br />
Spule in die Antenne zu integrieren, d. h.<br />
die Antenne um einen bestimmten Betrag<br />
in der Resonanzfrequenz nach unten zu<br />
verschieben, also elektrisch länger zu<br />
machen.<br />
■ Vorteilhaft: Verlängern<br />
Aus Tabellen [3] läßt sich durch einfache<br />
Umrechnung entnehmen, um wieviel man<br />
die Antenne länger machen muß. In unserem<br />
Fall ist die Resonanz auf etwa 1750<br />
bis 1760 kHz zu legen. Wir erreichen damit<br />
zusätzlich eine weitere (geringfügige)<br />
Erhöhung des Fußpunktwiderstands. Zudem<br />
wird der Strombauch in der T-Antenne<br />
noch ein klein wenig nach oben<br />
verschoben. Damit braucht man jetzt also<br />
nur noch ein Bauteil, um die Antenne an<br />
50-Ω-Kabel anzupassen: einen Kondensator<br />
(C P).<br />
■ Erfolge<br />
Die Erfolge mit dieser T-Antenne (Bild 2)<br />
waren überzeugend: Innerhalb eines Vierteljahres<br />
habe ich u. a. folgende DX-Länder<br />
auf 160 m erreicht: JA, VK, ZL, VU2,<br />
ZS, PY, UA0, W, VE, VS6, FM, KP2, 5H,<br />
JY und EA8. Bei Feldstärkevergleichen<br />
zwischen einem Dipol in gleicher Höhe<br />
und der T-Antenne gab es in QSOs mit<br />
VK/ZL bei der T-Antenne oft eine bis zwei<br />
S-Stufen mehr! Parallele Tests mit ge-<br />
L R<br />
[μH]<br />
2<br />
1,5<br />
1<br />
0,5<br />
0<br />
0<br />
R 1 . RA<br />
X LRi<br />
und<br />
1<br />
XCP = .<br />
2 π f CP C P<br />
L R<br />
0<br />
10 20 30 40 50<br />
RA [Ω]<br />
Bild 3: Nomogramm zur Bestimmung von L R<br />
und C P <strong>für</strong> eine Frequenz von 1,83 MHz<br />
C P<br />
[nF]<br />
8<br />
6<br />
4<br />
2<br />
Amateurfunktechnik<br />
ringer Leistung (1 W Output) brachten im<br />
gleichen Zeitraum vier Kontinente ein. Es<br />
fehlten nur QSOs mit Südamerika und<br />
Ozeanien, um mit 1 W das WAC 160 m zu<br />
erreichen... <strong>Das</strong> möchte ich bei Gelegenheit<br />
nachholen.<br />
■ Aufbau der Antenne<br />
Zwischen einem Gittermast und einem<br />
hohen Baum (etwa 80 m entfernt) habe ich<br />
ein Perlon-Tragseil mit dazwischen eingefügter<br />
Antenne verspannt, auf der darunter<br />
befindlichen Wiese 50 Radials verlegt<br />
und den in der näheren Umgebung des<br />
Speisepunkts befindlichen Bereich (Radius<br />
etwa 10 m) zusätzlich mit engmaschigem<br />
Drahtgeflecht („chicken-wire“)<br />
belegt, das mit den Radials verbunden<br />
wurde. Über Umlenkrollen konnte die Antenne<br />
schnell hochgezogen und auch wieder<br />
herabgelassen werden, um mit der<br />
Länge der horizontalen Drähte Resonanzkorrekturen<br />
vorzunehmen.<br />
Die angegebenen Längen der horizontalen<br />
Drähte („Dachkapazität“) sind Richtwerte<br />
und können je nach Höhe der Antenne<br />
geringer oder größer werden. Nützliche<br />
Dienste leistet hierbei ein Dipmeter oder<br />
eine Antennenmeßbrücke.<br />
Abgleich und Inbetriebnahme vollziehen<br />
sich nach folgendem Schema: Antenne<br />
hochziehen und (ohne C P!) Resonanzfrequenz<br />
auf etwa 1750 bis 1760 kHz legen<br />
(horizontale Drähte verkürzen oder verlängern).<br />
C P anschließen und auf niedrigstes<br />
SWR abgleichen. Optimierung durch<br />
geringfügige Längenkorrektur der horizontalen<br />
Drähte und Verändern des C P-<br />
Wertes. Und schon kann es mit dem DXen<br />
losgehen [4].<br />
Aus dem Nomogramm Bild 3 können die<br />
Werte <strong>für</strong> C P und L R bei Bedarf entnommen<br />
werden. L R ist jedoch nur dann gültig,<br />
wenn die Antenne bei 1,83 MHz resonant<br />
ist und ihre Resonanzfrequenz nicht nach<br />
unten verlegt wurde (s.o.).<br />
Literatur<br />
[1] The W2FMI ground-mounted short vertical,<br />
QST 57 (1973), H. 3<br />
[2] How long is a piece of wire?, Electronics &<br />
Wireless World (1985), H. 4<br />
[3] ARRL Antenna Book, 14th Edition<br />
[4] Bobek, P., DJ8WL: DXen auf 160 m, Amateurfunk<br />
Almanach 1994<br />
Weitere Informationsquellen<br />
[5] Radio Communication Handbook, RSGB<br />
[6] Efficiency of short antennas, Ham Radio, (1982),<br />
H. 9<br />
[7] Optimum ground systems for vertical antennas,<br />
QST 60 (1976), H. 12<br />
[8] A modest 45-foot dx-vertical, QST 65 (1981),<br />
H. 9<br />
[9] Effective grounds, CQ (1982), H. 8<br />
[10] Short antennas for the lower frequencies (1),<br />
QST 54 (1970), H. 8<br />
FA 6/95 • 641