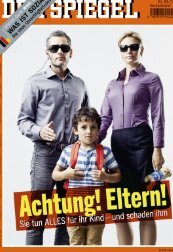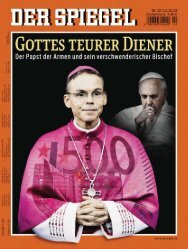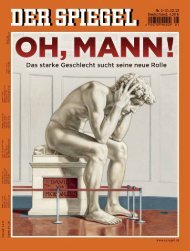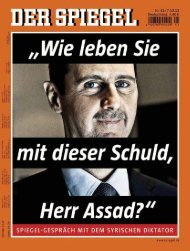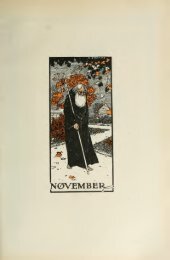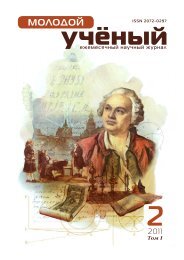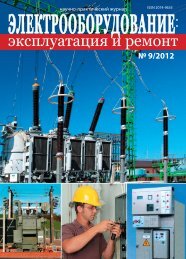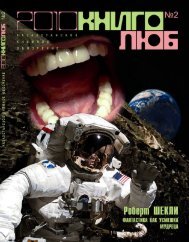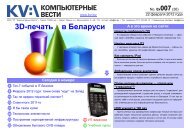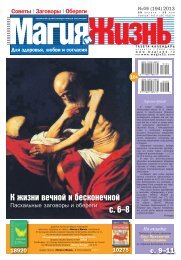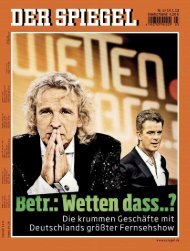Das Magazin für Funk Elektronik · Computer
Das Magazin für Funk Elektronik · Computer
Das Magazin für Funk Elektronik · Computer
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Amateurfunktechnik<br />
Bild 8: Der fertige Abschlußwiderstand. Der<br />
Deckel ist perforiert, damit die vom Lüfter<br />
geförderte Luft ausströmen kann.<br />
Fotos: Autor<br />
Zwischen diese drei Bleche werden nun<br />
die Widerstände mit gekürzten Anschlußdrähten<br />
versetzt eingelötet. Es empfiehlt<br />
sich der Gebrauch eines (etwa) 100-W-<br />
Lötkolbens mit schlanker Spitze. Erstens<br />
ist die Wärmeableitung auf den Blechen<br />
nicht zu verachten, zweitens muß man<br />
zügig löten und drittens ist infolge der<br />
versetzten Widerstände wenig Platz, speziell<br />
auf dem Mittelblech. <strong>Das</strong> Einlöten<br />
beginnt in der Mittelreihe jeweils links<br />
und rechts vom Mittelblech.<br />
Die verwendeten Einzelteile sind in der<br />
Stückliste erfaßt. Möchte man anstelle der<br />
T-Antenne <strong>für</strong> das 160-m-Band<br />
PETER BOBEK – DJ8WL<br />
Nur wenige Amateure haben die Möglichkeit, <strong>für</strong> das 160-m-Band eine<br />
ausgewachsene Vertikalantenne (Höhe etwa 40 m) aufstellen zu können.<br />
Häufig werden daher verkürzte Vertikals verwendet, um im DX-Geschäft<br />
einigermaßen mithalten zu können. Daraus ergeben sich jedoch Konsequenzen,<br />
insbesondere bezüglich Wirkungsgrad und Anpassung). Die<br />
im folgenden beschriebene T-Antenne trägt diesen Gesichtspunkten<br />
Rechnung.<br />
Eines sei vorweggesagt: Ein niedrig hängender<br />
Draht (weniger als 15 m über dem<br />
Erdboden) ist sicher gut <strong>für</strong> den europäischen<br />
„Nahbereich“ bis etwa 1500 km,<br />
darüber hinaus geht aber meist nichts<br />
mehr. Dies hängt mit der steil nach oben<br />
gerichteten Abstrahlung einer solchen<br />
Antenne zusammen. Selbst bei guten<br />
Ausbreitungsbedingungen ist oft kein DX<br />
damit zu erreichen. Man muß dann neidisch<br />
zuhören, wie andere Stationen mit<br />
kurzen, aber optimal gestalteten Vertikalantennen<br />
den DX-Kuchen unter sich aufteilen...<br />
Auch ein niedrig hängender Dipol macht<br />
in dieser Hinsicht keine Ausnahme, ganz<br />
640 • FA 6/95<br />
BNC-Buchse eine UHF-PL-Steckverbindung<br />
vorsehen, sind die Befestigung des<br />
Widerstandsblockes und die Bohrungen<br />
diesen Gegebenheiten anzupassen.<br />
Im Unterteil des Gehäuses wurde der<br />
Lüfter montiert. In das Bodenblech habe<br />
ich dazu mit einen Metall-Laubsägeblatt<br />
ein Loch von 80 mm Durchmesser gesägt.<br />
Der Lüfter ist mit vier Schrauben M 3 × 15<br />
auf der Innenseite des Bodenblechs montiert,<br />
wobei die Schrauben außerdem noch<br />
das Lüftergitter und die vier Gerätefüße<br />
halten.<br />
Der Widerstandsblock sitzt etwa 5 mm<br />
über der Lüfteroberkante, wobei die BNC-<br />
Buchse der Befestigungspunkt des Blocks<br />
ist. Erst im montierten Zustand wird der<br />
Mittelkontakt der BNC-Buchse mit dem<br />
Mittelleiter des Widerstandsblockes verlötet.<br />
Die Stromversorgung des Lüfters<br />
erfolgt über eine Miniatur-Netzeinbausteckverbindung.<br />
■ Meßergebnisse<br />
Geplant war anfänglich der Einsatz von<br />
44 Widerständen 2200 Ω und <strong>für</strong> die Endvariante<br />
von 66 Widerständen zu 3300 Ω.<br />
Da die 2200-Ω-Widerstände aber die Anforderungen<br />
erfüllten, habe ich auf die<br />
zweite Widerstandsvariante verzichtet. Die<br />
Parallelschaltung ergab (bei 21 °C) einen<br />
Widerstandswert von 49,9 Ω, der bei<br />
Dauerlast mit 100 W auf 51,1 Ω anstieg.<br />
Mit einem digitalen SWV-Meßgerät<br />
abgesehen davon, daß er bei niedriger<br />
Höhe auch keinen 50-Ω-Abschluß <strong>für</strong> den<br />
Sender darstellt!<br />
Untersuchungen von W2FMI [1] haben<br />
ergeben, daß bei kurzen Vertikalantennen<br />
besonders dann hohe Wirkungsgrade erreichbar<br />
sind, wenn die Antenne verlängernde<br />
Elemente im Endbereich der Antenne<br />
integriert sind (z. B. Dachkapazitäten<br />
und Ladespulen). Ein nicht zu unterschätzendes<br />
Problem stellt außerdem das<br />
benötigte Erdsystem dar. Letzteres ist<br />
dann oft der Grund, warum man doch<br />
lieber ein horizontales Drähtchen zum<br />
Strahlen bewegen möchte. Da kurze Vertikalantennen<br />
auch einen niedrigen Fuß-<br />
wurde das SWV im KW-Bereich ermittelt.<br />
Es verläuft gleichförmig von 1:1,03 bei<br />
1,8 MHz bis 1 : 1,26 bei 29 MHz.<br />
Wichtig war noch die Dauerbelastbarkeit<br />
des Abschlußwiderstandes. Der Einfachheit<br />
halber wurde die Lufttemperatur unmittelbar<br />
über dem perforierten Deckel<br />
des Gehäuses gemessen. Der erste Versuch<br />
(s. Bild 4) verlief mit 50 W ohne<br />
Lüfter. Nach 6 min stieg die Temperatur<br />
rasch an, wobei der typische Geruch nach<br />
„heißem“ Widerstand auftrat. Eine Sichtkontrolle<br />
ergab jedoch noch keine Farbveränderung<br />
der Widerstände. Nach Abkühlung<br />
habe ich den Versuch wiederholt,<br />
wobei 6 min später der Lüfter zugeschaltet<br />
wurde. Nach der Temperaturstabilisierung<br />
wurde die HF abgeschaltet, wobei<br />
jedoch der Lüfter weiterlief.<br />
Bild 5 enthält die Ergebnisse bei 100 W HF<br />
und eingeschaltetem Lüfter. Nach etwa 20<br />
min ist die Temperaturstabilisierung (thermisches<br />
Gleichgewicht, Endtemperatur)<br />
erreicht. Eine Farbveränderung der Widerstände<br />
sowie der Hitzegeruch ergaben sich<br />
auch hier nicht. Damit entfiel die Notwendigkeit<br />
einer Meßreihe mit den 3300-Ω-<br />
Widerständen.<br />
Zusammenfassend läßt sich feststellen, daß<br />
man auch mit einfachen Mitteln einen robusten<br />
Kurzwellen-Abschlußwiderstand<br />
mit erträglichem SWV bauen kann.<br />
Alle Rechte der kommerziellen Nutzung<br />
und Verwertung beim Autor!<br />
punktwiderstand aufweisen, ist die Anpassung<br />
auch nicht so einfach.<br />
Wer sich allerdings der Mühe unterzieht<br />
und ein halbwegs brauchbares Erdnetz auslegt,<br />
macht 160 m mit einer kurzen Vertikal<br />
zu einem DX-Band, das sich sehen<br />
lassen kann: 150 Länder sind ohne weiteres<br />
„drin“. Versuchen Sie es nicht erst<br />
mit drei Radials, es sei denn, Sie legen<br />
keinen großen Wert auf ein noch in 6 000<br />
bis 15 000 km Entfernung hörbares Signal!<br />
Der Unterschied zwischen einem guten<br />
und einem schlechten Erdnetz kann im<br />
Fernfeld bis zu 2 S-Stufen ausmachen!<br />
■ Wirkungsgrad<br />
einer kurzen Vertikalantenne<br />
Der Wirkungsgrad läßt sich relativ einfach<br />
mit der bekannten Formel<br />
R A<br />
η =<br />
RA + RE + RV beschreiben, wobei η der Wirkungsgrad;<br />
RA der theoretische Wert des Fußpunktwiderstands,<br />
RE die Erdverluste und RV sonstige weitere Verluste sind.<br />
Beispiel: Eine 18 m hohe Vertikal <strong>für</strong> 160 m<br />
(RA = 5,6 Ω) mit Verlängerungsspule im<br />
Speisepunkt, einem Erdnetz aus zehn Ra-