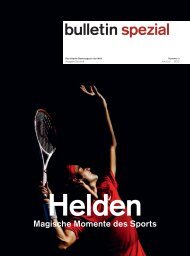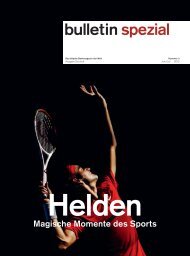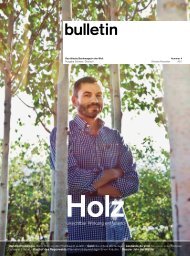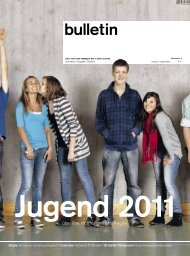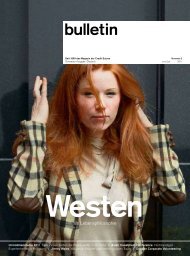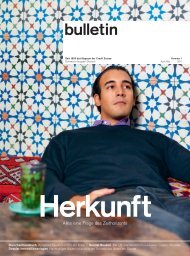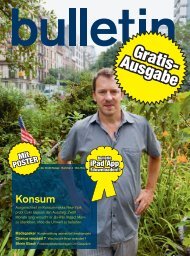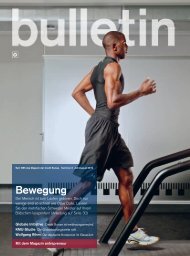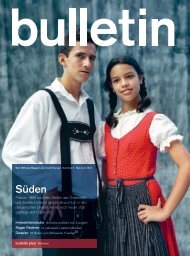bull_08_03_Ozean
Credit Suisse bulletin, 2008/03
Credit Suisse bulletin, 2008/03
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Wirtschaft Weltweite Infl ation 53<br />
angeführt, aber im Wesentlichen liegen den<br />
Preissteigerungen fundamentale Faktoren<br />
zugrunde. Auf der Nachfrageseite haben<br />
die Konsumenten in den Schwellenländern<br />
mit zunehmendem Wohlstand ihre Ernährungsgewohnheiten<br />
geändert. Der Durchschnittsverbrauch<br />
an Fleisch, dessen Produktion<br />
besonders viel Getreide und Wasser<br />
beansprucht, hat in den Schwellenländern<br />
rasant zugenommen.<br />
Auf der Angebotsseite verzeichneten<br />
mehrere Kulturpflanzen in den letzten Jahren<br />
stagnierende oder sogar rückläufige Ernten,<br />
was teilweise auf Klimaänderungen zurückzuführen<br />
ist. Historisch gesehen folgen die<br />
Inlandspreise für Nahrungsmittel nicht immer<br />
den weltweiten Preisschwankungen.<br />
Das liegt zum Teil an regulatorischen Verzerrungen<br />
wie Subventionen und Zöllen sowie<br />
der damit verbundenen Abschottung der<br />
inländischen Nahrungsmittelpreise von der<br />
Entwicklung auf den Weltmärkten. Dennoch<br />
war der zuletzt starke Anstieg der weltweiten<br />
Nahrungsmittelpreise in den meisten<br />
Ländern mit einer deutlichen Zunahme der<br />
Nahrungsmittelinflation verbunden.<br />
Die höheren Ölpreise lassen sich weitgehend<br />
mit einer nach wie vor robusten Konjunktur<br />
in vielen Schwellenländern erklären,<br />
auch wenn sich das Wachstum in den USA<br />
und anderen Industrieländern verlangsamt<br />
hat. Die trotz markant gestiegener Preise<br />
starke Nachfrage aus den Schwellenländern<br />
ist zumindest teilweise darauf zurückzuführen,<br />
dass viele Entwicklungsländer versucht<br />
haben, die Inlandspreise durch Subventio nen<br />
nach oben zu begrenzen, um ihre Volkswirtschaften<br />
vor der Entwicklung auf den internationalen<br />
Energiemärkten abzuschirmen. In<br />
China beispielsweise haben sich die Benzinpreise<br />
seit 2000 nur verdoppelt, während sie<br />
in den USA fast um das Dreifache gestiegen<br />
sind. Die Ölnachfrage dürfte sich abschwächen,<br />
sobald sich die Konsumenten anstelle<br />
von künstlich tief gehaltenen Inlandspreisen<br />
mit Preisen konfrontiert sehen, die näher am<br />
Weltmarktniveau liegen. Dies sollte überdies<br />
helfen, das Nachfragewachstum einzudämmen<br />
und weitere Preisanstiege zumindest<br />
kurzfristig zu begrenzen.<br />
Andererseits sind die Bedenken hinsichtlich<br />
der Vorräte wie schon bei den Nahrungsmitteln<br />
in jüngster Zeit gewachsen. Die Internationale<br />
Energieagentur (IEA) hat angedeutet,<br />
dass sie ihre langfristigen<br />
Vor rats prognosen nach unten korrigieren<br />
werde, was in den letzten Wochen zu einer<br />
markanten Neubewertung der langfristigen<br />
Preiserwartungen geführt hat. Die steigen de<br />
Inflation hat die Kaufkraft amerikanischer<br />
Konsumenten bereits gesenkt. So gaben<br />
die Konsumenten in den USA im ersten<br />
Quartal beispielsweise 109 Milliarden Dollar<br />
für Benzin aus. Dies entspricht einer Zunahme<br />
von rund 30 Prozent gegenüber dem<br />
Vorjahreszeitraum. Die steigen de Inflation<br />
hat auch negative Auswirkungen auf die Gewinne<br />
der Unternehmen, sofern diese die<br />
höheren Faktorkosten nicht weitergeben<br />
können. Insbesondere in den USA, wo sich<br />
die Inlandsnachfrage momentan abschwächt,<br />
bekunden die Unternehmen Mühe, ihre Preise<br />
zu erhöhen.<br />
Ein weiteres Risiko besteht darin, dass<br />
eine höhere Inflation zu höheren Inflationserwartungen<br />
und somit zu Lohnerhöhungen<br />
führt. Aus höheren Löhnen könnten wiederum<br />
höhere Preise resultieren, falls die Unternehmen<br />
versuchen, ihre Gewinnmargen<br />
zu wahren. Im Extremfall entsteht daraus<br />
eine Lohn-Preis-Spirale.<br />
Es gibt mehrere Gründe, weshalb das<br />
Risiko einer länger anhaltenden Inflation in<br />
den Schwellenländern grösser ist. Die Löhne<br />
sind nach wie vor niedrig, und oft mangelt<br />
es an qualifiziertem Personal. Demgegenüber<br />
sehen sich Arbeitnehmer in den Industrieländern<br />
weiterhin einem internationalen<br />
Wettbewerb ausgesetzt, was ihre Lohnforderungen<br />
begrenzen dürfte. Ausserdem haben<br />
Schwellenländer tragen die Hauptlast<br />
Höhere Nahrungsmittelpreise bergen grössere Risiken für Schwellenländer,<br />
da die Bevölkerung ärmer ist und ein grösserer Anteil der Ausgaben auf Nahrungsmittel<br />
entfällt. Quelle: World Bank, inländische Quellen, Credit Suisse<br />
Philippinen<br />
Vietnam*<br />
Thailand*<br />
China<br />
Malaysia*<br />
Indonesien<br />
Südafrika<br />
Brasilien<br />
Euroraum<br />
Indien<br />
USA<br />
sie in den letzten Jahren von einer stabilen<br />
Inflation auf niedrigem Niveau profitiert.<br />
Viele werden deshalb die zurzeit hohen Inflationsraten<br />
als vorübergehendes Phänomen<br />
erachten, das die Realeinkommen zwar<br />
kurzfristig schmälern wird, aber schon bald<br />
wieder nachlassen könnte.<br />
Demgegenüber haben die Konsumenten<br />
in den Schwellenländern in jüngster Zeit immer<br />
wieder Phasen hoher Inflation erlebt<br />
und dürften deshalb befürchten, dass diese<br />
zurückkehren. Nahrungsmittel machen einen<br />
beträchtlichen Anteil am Warenkorb<br />
von armen Konsumenten in den Schwellenländern<br />
aus, weshalb der steile Anstieg der<br />
Nahrungsmittelpreise zu einer existenziellen<br />
Bedrohung werden kann. Aus diesem Grund<br />
dürften die Arbeitnehmer in den Schwellenländern<br />
hartnäckiger Lohnerhöhungen fordern<br />
als in den Industrieländern.<br />
Viele Unternehmen in den Industrieländern<br />
haben die Preise ihrer Produkte zwar<br />
angehoben, um den höheren Faktorkosten<br />
Rechnung zu tragen, aber die meisten konnten<br />
diese Kostensteigerungen wegen der<br />
rückläufigen Nachfrage nicht vollumfänglich<br />
weitergeben. In den meisten Schwellenländern<br />
bleibt der Konsum dagegen robust,<br />
und viele Unternehmen arbeiten an der<br />
Kapazitätsgrenze. Ihnen bieten sich daher<br />
mehr Anreize und Möglichkeiten, die Preise<br />
zu erhöhen. <<br />
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%<br />
Gewichtung von Nahrungsmitteln im Konsumentenpreisindex (KPI)<br />
Bevölkerung mit weniger als 1 Dollar pro Tag in % der Gesamtbevölkerung<br />
(* unter 2%)<br />
Credit Suisse Bulletin 3/<strong>08</strong>