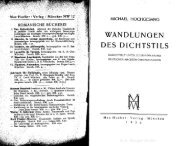Diplomarbeit - Leben und Werk des Dichters Gottfried August Bürger
Diplomarbeit - Leben und Werk des Dichters Gottfried August Bürger
Diplomarbeit - Leben und Werk des Dichters Gottfried August Bürger
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
angesehenen Schule, die ihm das finanzielle Auskommen ermöglicht.<br />
In Königsberg, an der Peripherie <strong>des</strong> preußischen Machtbereiches, macht sich der Rückgang <strong>des</strong><br />
adeligen Mäzenatentums bemerkbar. Die Stadt, nur noch ein politischer Nebenschauplatz, bietet<br />
dadurch eine gewisse intellektuelle Freiheit für bürgerliche Geister – gleichzeitig aber immer noch<br />
solide institutionelle Voraussetzungen <strong>und</strong> ein finanzkräftiges Großbürgertum als Publikum. 63 In<br />
diesem Klima nimmt im universitären Kreis vor allem sein Lehrer Kant, gegen den er sich kritisch<br />
abgrenzt, intellektuellen Einfluss auf Herder <strong>und</strong> außerhalb der Universität die Fre<strong>und</strong>schaft mit<br />
Johann Georg Hamann sowie die französischen Aufklärer, vor allem die Schriften Rousseaus – der<br />
ihm als Vermittlerfigur zur Philosophie <strong>des</strong> frühen Kant dient. Hamann macht ihn mit Shakespeare<br />
<strong>und</strong> englischer Dichtung bekannt <strong>und</strong> bestärkt ihn, im Anschluss an die Lektüre Rousseaus <strong>und</strong><br />
Bacons, in Erfahrung <strong>und</strong> Beobachtung den Schlüssel für Sprache <strong>und</strong> Dichtung zu finden. Gleichzeitig<br />
schließt sich Herder einem Kreis von aufgeklärten Intellektuellen an, zu dem sowohl Kant <strong>und</strong><br />
Hamann als auch Theodor Gottlieb von Hippel, der rasante Karriere in der preußischen Verwaltung<br />
machte, <strong>und</strong> Johann Georg Scheffner gehörten. Die Integration der aufsteigenden Intellektuellen<br />
erfolgt nicht zuletzt auch über die gemeinsame Teilhabe an der Freimaurerloge „Zu den drei Kronen“,<br />
in der alle Intellektuellen außer Kant <strong>und</strong> Hamann Mitglieder sind. Gerade Hamann <strong>und</strong> Hippel<br />
wenden sich mit Herder gegen die rationalistische Aufklärung Kants. Wie János Rathmann hinweist,<br />
ist für Herders Volkskonzeption gerade das produktive Denken der Hamannschen Sprachtheorie<br />
wichtig; damit wird die Sprache stark aufgewertet <strong>und</strong> mit ihr Kultur, Dichtung <strong>und</strong> Lieder. 64 Im<br />
November 1764 tritt Herder eine Stelle an der Domschule in Riga an.<br />
3.1.1. Haben wir noch jetzt das Publikum <strong>und</strong> Vaterland der Alten?<br />
Zur Einweihung <strong>des</strong> Gerichtshauses in Riga am 11.10.1765 schreibt Herder im Auftrag <strong>des</strong> Stadtrates<br />
eine Festschrift mit dem Titel Haben wir noch jetzt das Publikum <strong>und</strong> Vaterland der Alten?. Die Schrift<br />
ist sicherlich auch als Anempfehlung der eigenen Person an Katharina II. zu sehen, nicht zuletzt<br />
aufgr<strong>und</strong> der für das Frühwerk singulären Nennung der Autorschaft. 65 Herder schreibt selbst, ihm<br />
„fehlen die Türen zu Bekanntschaften“ 66 – er findet sich in der Position <strong>des</strong> Neulings im<br />
intellektuellen <strong>und</strong> literarischen Feld Rigas.<br />
Die eigene Stellung Herders im <strong>Werk</strong> oszilliert noch zwischen Selbstbewusstsein (er nennt sich „J. G.<br />
Herder, Mitarbeiter der Domschule“ 67 ) <strong>und</strong> Unsicherheit (Herder entschuldigt sich „warum ich diese<br />
Abhandlung schreibe, <strong>und</strong> auf öffentlichen Wink gemein mache“ 68 ) über die eigene Position. Dabei<br />
63 Vgl. Namowicz: Zentrum an der Peripherie, S. 140. – Der Aufsatz bietet einen guten Überblick über das<br />
literarische <strong>Leben</strong> <strong>und</strong> die institutionellen Voraussetzungen im Königsberg der Mitte <strong>des</strong> 18. Jahrh<strong>und</strong>erts.<br />
64 Vgl. Rathmann: „Volks“-Konzeption bei Herder, S. 56.<br />
65 Vgl. Gaier: Kommentar zu Publikum <strong>und</strong> Vaterland der Alten, S. 918.<br />
66 Zit. nach Kantzenbach: Herder, S. 24.<br />
67 Herder: Publikum <strong>und</strong> Vaterland der Alten, S. 40.<br />
68 Herder: Publikum <strong>und</strong> Vaterland der Alten, S. 41.<br />
21




![ERNSTEN BALIADE DIIR(]H G. A. BÃRGnR. - Leben und Werk des ...](https://img.yumpu.com/50237579/1/190x146/ernsten-baliade-diirh-g-a-bargnr-leben-und-werk-des-.jpg?quality=85)