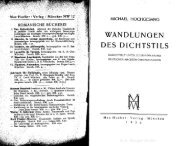Diplomarbeit - Leben und Werk des Dichters Gottfried August Bürger
Diplomarbeit - Leben und Werk des Dichters Gottfried August Bürger
Diplomarbeit - Leben und Werk des Dichters Gottfried August Bürger
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Zustan<strong>des</strong>, aber auch Hoffnung auf eine Rückkehr zur Natur <strong>und</strong> einer neuen Totalität. 253 Gerade die<br />
Bestimmung <strong>des</strong> Menschen durch den episch-mythischen Geschichtsgang <strong>und</strong> die Lokalisierung <strong>des</strong><br />
Mythos in den einzelnen Völkern ist zentral in den Konzepten der Brüder Grimm.<br />
3.5.2.2. Volk <strong>und</strong> das Sich-selbst-dichtende Epos<br />
Vor diesem Hintergr<strong>und</strong> entwickelten Jacob <strong>und</strong> Wilhelm Grimm ihre Konzepte von Volk, Geschichte<br />
<strong>und</strong> Poesie. Mehr als bei allen anderen bisher behandelten Autoren sind die Begriffe ineinander<br />
verwischt <strong>und</strong> kaum voneinander zu trennen. Dies wird in einer Stelle aus Jacob Grimms Von<br />
Übereinstimmung der alten Sagen (1807) deutlich:<br />
Die älteste Geschichte jedwe<strong>des</strong> Volkes ist Volkssage. Jede Volkssage ist episch. Das Epos ist alte<br />
Geschichte. Alte Geschichte <strong>und</strong> alte Poesie fallen notwendig zusammen. In beiden ist vermöge ihrer<br />
Natur die höchste Unschuldigkeit (Naivetät) offenbar. So wie es aber unmöglich ist, die alte Sage auf<br />
dieselbe Art zu behandeln, wie mit der neueren Geschichte verfahren werden muß (welche vielleicht<br />
mehr Wahrheit <strong>des</strong> Details enthält, wogegen in den Sagen bei allem fragmentarischen eine<br />
hervorgreifende Wahrheit in Auffassung <strong>des</strong> Totaleindrucks der Begebenheit herrscht), so ungereimt<br />
ist es, ein Epos erfinden zu wollen, denn je<strong>des</strong> Epos muß sich selbst dichten, von keinem Dichter<br />
geschrieben werden. […] Aus dieser volksmäßigkeit <strong>des</strong> Epos ergibt sich auch, dass es nirgends anders<br />
entsprungen sein kann, als unter dem Volke, wo sich die Geschichte zugetragen hat. 254<br />
Hier wird die Ineinssetzung von Geschichte <strong>und</strong> Volkspoesie deutlich. Volkspoesie hat epischen<br />
Charakter <strong>und</strong> ist damit alte Geschichte; damit verb<strong>und</strong>en sind die Teilhabe an der natürlichen<br />
Naivität <strong>und</strong> der Zugang zu einer Totalität, die jenseits <strong>des</strong> Gemachten liegt. Insofern kann epische<br />
Dichtung nicht erf<strong>und</strong>en werden. Als Ursprung gibt Grimm das Volk an, das gleichzeitig Ort der<br />
Geschichte <strong>und</strong> Medium der Poesie ist. Das Volk wird dabei als abstraktes Kollektivsubjekt imaginiert.<br />
In Gedanken: wie sich die Sagen zur Poesie <strong>und</strong> Geschichte verhalten (1808, veröffentlicht in der<br />
Zeitung für Einsiedler) führt Jacob Grimm diesen Gedanken anhand der Differenz von Natur- <strong>und</strong><br />
Kunstpoesie weiter:<br />
Man streite <strong>und</strong> bestimme, wie man wolle, ewig gegründet, unter allen Völker- <strong>und</strong> Länderschaften ist<br />
ein Unterschied zwischen Natur- <strong>und</strong> Kunstpoesie (epischer <strong>und</strong> dramatischer, Poesie der<br />
Ungebildeten <strong>und</strong> Gebildeten) <strong>und</strong> hat die Bedeutung, daß in der epischen die Taten <strong>und</strong> Geschichten<br />
gleichsam einen Laut von sich geben, welcher forthallen muß, <strong>und</strong> das ganze Volk durchzieht,<br />
unwillkürlich <strong>und</strong> ohne Anstrengung, so treu, so rein, so unschuldig werden sie behalten, allein um<br />
ihrer selbst willen, ein gemeinsames, teures Gut gebend, <strong>des</strong>sen ein jedweder Teil habe. 255<br />
Die Differenz Natur- <strong>und</strong> Kunstpoesie wird ihrerseits enthistorisiert <strong>und</strong> verallgemeinert. 256 Die<br />
Parallelen, die Grimm setzt, grenzen sie deutlich zum literarischen Feld ab: Sie ist eben nicht Poesie<br />
der Gebildeten, eben nicht die dramatische Poesie der Fürstenhöfe. Die Nähe von Volkspoesie, Tat<br />
<strong>und</strong> Geschichte macht sie zum Zeugnis <strong>des</strong> Geschichtsprozesses selbst. Das Volk ist Medium <strong>des</strong><br />
253 Vgl. Ehrismann: Philologie, S. 48f.<br />
254 Grimm: Von Übereinstimmung der alten Sagen, S. 39.<br />
255 Grimm: Wie sich Sagen zur Poesie <strong>und</strong> Geschichte verhalten, S. 40.<br />
256 Alexander von Bormann zu Folge besteht genau hierin die ästhetische Operation. Vgl. Bormann: Volk als<br />
Idee, S. 46, 50.<br />
63




![ERNSTEN BALIADE DIIR(]H G. A. BÃRGnR. - Leben und Werk des ...](https://img.yumpu.com/50237579/1/190x146/ernsten-baliade-diirh-g-a-bargnr-leben-und-werk-des-.jpg?quality=85)