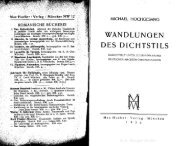Diplomarbeit - Leben und Werk des Dichters Gottfried August Bürger
Diplomarbeit - Leben und Werk des Dichters Gottfried August Bürger
Diplomarbeit - Leben und Werk des Dichters Gottfried August Bürger
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
studierten) sowie Schelling <strong>und</strong> seinem Mythosbegriff an.<br />
Herder kann sicherlich als einer der wichtigsten Einflüsse bezeichnet werden, was die Etablierung von<br />
Volkspoesie <strong>und</strong> die Hinwendung zum Volk als Quelle literarischer Erfahrung betrifft. Auch die<br />
Verknüpfung von geschichtsphilosophischer Betrachtung <strong>und</strong> dem Sammeln von Volkspoesie findet<br />
bei Herder ihren Vorläufer. Auch die wichtige Differenz zwischen Natur- <strong>und</strong> Kunstpoesie <strong>und</strong> die<br />
rückwärtsgewandte Utopie zeigen Übereinstimmungen mit Herder – <strong>und</strong> in weiterer Folge auch mit<br />
Rousseau. 247<br />
Von seinem ehemaligen Lehrer Carl Friedrich von Savigny übernahm Jacob Grimm „die Idee der<br />
Geschichtlichkeit aller Ausdrucksformen <strong>des</strong> Volksgeistes“ 248 . Savignys geschichtsphilosophisches<br />
Modell verläuft parabolisch: Am Anfang nimmt er einen tierischen (natürlich totalen) Zustand an, in<br />
dem Recht <strong>und</strong> Praxis in eins gedacht werden. Den Höhepunkt der Rechtsentwicklung sieht er im<br />
römischen Recht, wo Kodifikation <strong>und</strong> Praxis in einem perfekten Verhältnis stehen. Ab da konstatiert<br />
er einen bis in seine Gegenwart andauernden Verfall, im Zuge <strong>des</strong>sen (künstliche) Kodifikation <strong>und</strong><br />
(natürliche) Praxis auseinandertreten. An diesen am Volksgeist <strong>und</strong> seiner Entsprechung im Recht<br />
orientierten Standpunkt schloss Jacob Grimm mit seinem Poesieverständnis an. Er nimmt ebenfalls<br />
einen perfekten Anfang an, verbindet diesen jedoch mit einer rousseauistischen Utopie eines<br />
vollkommenen Urzustan<strong>des</strong>, in dem Natur, Poesie, Epos, Geschichte <strong>und</strong> Volk in eins gedacht<br />
werden. Analog zu Savigny nimmt Jacob Grimm ab da einen steten Verfall an, innerhalb <strong>des</strong>sen sich<br />
Natur- <strong>und</strong> Kunstpoesie <strong>und</strong> Geschichte differenzieren. So wie Savigny das Recht in Bewusstsein <strong>und</strong><br />
der konkreten Rechtspraxis <strong>des</strong> Volkes findet, sucht Grimm die Naturpoesie an Stellen der Berührung<br />
von Geschichte, Poesie <strong>und</strong> Volk.<br />
Auf die Analogien zum Denken Schellings macht Otfrid Ehrismann aufmerksam, demgemäß sich in<br />
diesem Spannungsfeld „die Logik der Philologie“ zu erkennen gäbe. 249 In Schellings mythologischer<br />
Philosophie ist „der Abstieg aus der mythischen Zeit zugleich der Eintritt in eine neue mythische<br />
Zeit“. 250 Der Mythos ist dabei eine im Schöpfungsakt freigesetzte Kraft, die sich durch die Geschichte<br />
bewegt. Somit wird die Erforschung der alten Mythen zur „Erkenntnis <strong>des</strong> Göttlichen, Epischen in<br />
uns. Den Menschen bestimmt, wie die Geschichte der epische Prozeß – bei den Deutschen der<br />
nibelungische“. 251 Der Mythos umfasst dabei Vergangenheit, Gegenwart <strong>und</strong> Zukunft. Die<br />
Vergangenheit wird dabei als Identität gedacht, als Zustand ohne Subjekt-Objekt-Spaltung. 252 Für<br />
Gegenwart <strong>und</strong> Zukunft herrschen sowohl Trauer über den Untergang <strong>des</strong> selbstidentischen<br />
247 Vgl. Thalheim: Natur- <strong>und</strong> Kunstpoesie, S. 1834f.<br />
248 Wyss: Die wilde Philologie, S. 60.<br />
249 Ehrismann: Philologie der Natur, S. 36. – Ehrismann spricht sich gegen eine starke Beeinflussung der Grimms<br />
durch Herder oder Savigny aus <strong>und</strong> zeigt die Unterschiede in deren Denken auf.<br />
250 Ehrismann: Philologie, S. 40.<br />
251 Ehrismann: Philologie, S. 43.<br />
252 Vgl. Ehrismann: Philologie, S. 45.<br />
62




![ERNSTEN BALIADE DIIR(]H G. A. BÃRGnR. - Leben und Werk des ...](https://img.yumpu.com/50237579/1/190x146/ernsten-baliade-diirh-g-a-bargnr-leben-und-werk-des-.jpg?quality=85)