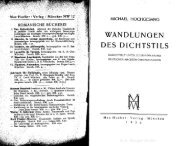Diplomarbeit - Leben und Werk des Dichters Gottfried August Bürger
Diplomarbeit - Leben und Werk des Dichters Gottfried August Bürger
Diplomarbeit - Leben und Werk des Dichters Gottfried August Bürger
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Forthallens (hier ist bereits eine Dekonstruktion <strong>des</strong> Volksbegriffes als durchlässig <strong>und</strong> unfassbar<br />
angelegt), das aber keinen aktiven Anteil an der Entstehung der Volkspoesie hat. Gerade das<br />
unwillkürliche Fortpflanzen der Volkspoesie wird zum Garant ihrer Reinheit <strong>und</strong> Treue. Die<br />
gemeinsame Teilhabe am autonomen autoreflexiven Allgemeinen wird zum gemeinschaftsbildenden<br />
Element. Dagegen setzt Grimm die Kunstpoesie, der er Solipsismus vorwirft.<br />
Als entzweien<strong>des</strong> Element setzt Jacob Grimm die Bildung, in deren Folge „die alte Poesie aus dem<br />
Kreis ihrer Nationalität unter das gemeine Volk, das der Bildung unbekümmerte, flüchten [mußte], in<br />
<strong>des</strong>sen Mitte sie niemals untergegangen ist“. 257 Das gemeine Volk wird hier vom Kreis der<br />
Nationalität unterschieden. Für Grimm bildet das gemeine Volk (das wiederum nicht gleichzusetzen<br />
ist mit den unterbürgerlichen Schichten wie die Sammelpraxis der Märchen zeigt) insofern nicht die<br />
Nation selbst, die als umfassenderes Paradigma konzipiert ist. So spricht er davon, dass „aus<br />
Volkssagen, d.h. Nationalsagen, Volkssagen, d.h. <strong>des</strong> gemeinen Volks geworden sind.“ 258 Der Begriff<br />
Volk wird von Grimm in zwei unterschiedlichen Bedeutungsschattierungen benutzt: Zum einen meint<br />
er die Nation, zum anderen das gemeine Volk (jedoch nicht den Pöbel).<br />
Für Grimm sind die Volkssagen Kondensationen konkreter Erfahrungsgehalte eines Kollektivs. 259 So<br />
schreibt er: „In ihnen [den Sagen, TJ] hat das Volk seinen Glauben niedergelegt, den es von der Natur<br />
aller Dinge hegend ist, <strong>und</strong> wie es ihn mit seiner Religion verflicht, die ihm ein unbegreifliches<br />
Heiligtum erscheint voll Seligmachung.“ 260 Somit bilden sie für sich eine Wahrheit jenseits der<br />
„politischen Kunstgriffe“ <strong>und</strong> der „Urk<strong>und</strong>en, Diplome[n] <strong>und</strong> Chroniken“. 261<br />
Diese Wahrheit fasst der Aufsatz Gedanken über Mythos, Epos <strong>und</strong> Geschichte, der 1813 in Schlegels<br />
Deutschem Museum erschien, etwas genauer. Hier spricht Jacob Grimm vom „Trost[…] der<br />
Geschichte“, der durch die „Genoßenschaft <strong>und</strong> Gleichheit mit den gewesenen Menschen“<br />
erwächst. 262 Das Epos steht dabei für Grimm zwischen dem Göttlichen <strong>und</strong> dem Menschlichen,<br />
indem er „dem Volksepos weder eine reinmythische (göttliche) noch reinhistorische (factische)<br />
Wahrheit zuschreibt, sondern ganz eigentlich sein Wesen in die Durchdringung beyder setzt.“ 263 Die<br />
gegenseitige Durchdringung von mythischer <strong>und</strong> historischer Sphäre verortet den Geschichtsprozess<br />
257 Grimm: Wie sich Sagen zur Poesie <strong>und</strong> Geschichte verhalten, S. 41.<br />
258 Grimm: Wie sich Sagen zur Poesie <strong>und</strong> Geschichte verhalten, S. 41.<br />
259 Alexander Kluge spricht in Geschichte <strong>und</strong> Eigensinn vom „Zeitkern“ (756) der Märchen als von der<br />
„spezifische[n] Ökonomie der Phantasietätigkeit“, die „zu gesellschaftlichen Erfahrungen sich verhält, kurz,<br />
wenn wir beobachten, wie ein Märchen reale Erfahrung umkehrt.“ (757) Er sieht die Märchen als Speicher<br />
kollektiver Arbeitsprozesse Erfahrungsgehalte widerspiegeln, „die die gesamte deutsche Geschichte bis ins 10.<br />
oder 11. Jahrh<strong>und</strong>ert zurück kennzeichnen.“ (756) Dieser Bef<strong>und</strong> Kluges vor dem Hintergr<strong>und</strong> einer Analyse der<br />
Entwicklung einer Deutschen Produktionsöffentlichkeit ist aufschlussreich, wenngleich sein Bef<strong>und</strong> zur Genese<br />
lückenhaft ist <strong>und</strong> die Konstruktion der „Gattung Grimm“ noch nicht berücksichtigt. (Vgl. Kluge: Geschichte <strong>und</strong><br />
Eigensinn, S. 756-769)<br />
260 Grimm: Wie sich Sagen zur Poesie <strong>und</strong> Geschichte verhalten, S. 42.<br />
261 Grimm: Wie sich Sagen zur Poesie <strong>und</strong> Geschichte verhalten, S. 43.<br />
262 Grimm: Gedanken über Mythos, S. 94.<br />
263 Grimm: Gedanken über Mythos, S. 94.<br />
64




![ERNSTEN BALIADE DIIR(]H G. A. BÃRGnR. - Leben und Werk des ...](https://img.yumpu.com/50237579/1/190x146/ernsten-baliade-diirh-g-a-bargnr-leben-und-werk-des-.jpg?quality=85)