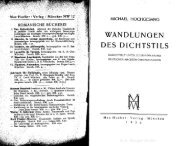Diplomarbeit - Leben und Werk des Dichters Gottfried August Bürger
Diplomarbeit - Leben und Werk des Dichters Gottfried August Bürger
Diplomarbeit - Leben und Werk des Dichters Gottfried August Bürger
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>und</strong> was mehr als alles gilt, die Denkart der Nation selbst National: das Volk mit ein so ansehnlicher<br />
Teil <strong>des</strong> Volks, <strong>des</strong>sen Namen man also nicht so Schamrot oder eckelnd <strong>und</strong> betroffen, ansah <strong>und</strong><br />
abscheute: der Gelehrte nicht bloß leider! für den Gelehrten <strong>und</strong> für den ärgsten von allen den<br />
Volksunwissenden Stubengelehrten, den Grübler, den Rezensenten, sondern für Nation! Volk! einen<br />
Körper, der Vaterland heißt! schreibend <strong>und</strong> sammlend <strong>und</strong> den wir Deutsche (so viel wir davon<br />
schwatzen, singen <strong>und</strong> schreiben) noch nichts weniger als haben, vielleicht nimmer haben werden<br />
[…]! 100<br />
Deutlich kämpft Herder hier gegen die diminutive Bedeutung <strong>des</strong> Volksbegriffes (als Synonym zu<br />
Pöbel) – Volk ist aber gleichzeitig der Einsatz gegen den klassischen Gelehrten <strong>und</strong> den<br />
Literaturbetrieb. Auffällig ist die doppelte Körpermetapher – das Volk bildet einen Körper, der<br />
Vaterland heißt <strong>und</strong> dieser Körper sind nicht zuletzt die Lieder. Hier der Körper als Ergebnis <strong>des</strong><br />
Sammelns gefasst, als fragmentiertes Ganzes, wobei dem Philologen die Rolle zukommt, die Teile zu<br />
einem organischen Ganzen zusammenzufügen <strong>und</strong> eine kulturelle Identität der Teile herzustellen.<br />
Die organische Metaphorik setzt sich fort, als Herder von Deutschland mit einer Baummetapher<br />
spricht oder es als „blutende Sklavin“ <strong>und</strong> „Kräfterschöpfende Säugamme“ bezeichnet. 101 Am<br />
einleitenden Satz wird auch fassbar, wie Herder die Begriffe „Nation“ <strong>und</strong> „Volk“ synonym gebraucht,<br />
wenngleich Wulf Koepke anmerkt, es muss „bei „Völker“ mehr an die konkreten Individuen gedacht<br />
werden, bei „Nationen“ an eine abstraktere oder ideelle Einheit.“ 102 Er schränkt jedoch ein, dass<br />
diese Unterscheidung nicht unbedingt zu verallgemeinern sei.<br />
An der Nation Deutschland lässt sich hier ablesen, dass Herder nunmehr auch den Volksbegriff<br />
zunehmend feminisiert. So sagt er: „Und nun nehme ich jeden Mann, <strong>und</strong> in dieser Gattung<br />
Gesanges noch lieber, je<strong>des</strong> Weib von Gefühl zu Zeugen [….].“ 103 Hier wird Sinnlichkeit <strong>und</strong><br />
Weiblichkeit verknüpft, der weibliche M<strong>und</strong> wird zum Mutterm<strong>und</strong> der Volksseele naturalisiert; die<br />
Konzeption Mutterm<strong>und</strong>es als Quelle der Volkspoesie tritt spätestens bei Jacob <strong>und</strong> Wilhelm Grimm<br />
wieder stark in den Vordergr<strong>und</strong>. 104<br />
In ihrer Begrifflichkeit werden die Begriffe Volk <strong>und</strong> Volkspoesie vor einem organisch-sinnlichen<br />
Hintergr<strong>und</strong> aufgespannt. Der Gegensatz dazu ist „vornehm, gebildet <strong>und</strong> allgesättigt“ 105 – denn<br />
Herder bestimmt die Sinnlichkeit anthropologisch:<br />
Wenn nun für die Sinne <strong>des</strong> Volks rührende, treue gute Geschichten, <strong>und</strong> keine Moral, eine Einzige<br />
Moral: für ihr Ohr rührend simple Töne <strong>und</strong> keine Musik, die einzige Musik ist: <strong>und</strong> wenn jede<br />
100 Herder: Volkslieder, S. 20.<br />
101 Herder: Volkslieder, S. 21,22. – Henning Buck sieht Herder hier als „‘Gestiker‘ <strong>des</strong> Leidens an Deutschland“<br />
(Buck: Spannungsfeld Volk-Nation-Europa, S. 24). Rudolf Große betont diesbezüglich: „Trotz aller biologischmetaphorischen<br />
Einkleidung […] sieht Herder die Entwicklung doch gesellschaftsgeschichtlich“, <strong>und</strong> betont den<br />
Aspekt der Praxis <strong>und</strong> der Dialektik zwischen einzelnem Subjekt <strong>und</strong> Gesellschaft (Große: „Volk“ bei Herder, S.<br />
306).<br />
102 Koepke: „Volk“ im Sprachgebrauch Herders, S. 213.<br />
103 Herder: Volkslieder, S. 18.<br />
104 Vgl. Kittler: Aufschreibesysteme, S. 35-37.<br />
105 Herder: Volkslieder, S. 17.<br />
29




![ERNSTEN BALIADE DIIR(]H G. A. BÃRGnR. - Leben und Werk des ...](https://img.yumpu.com/50237579/1/190x146/ernsten-baliade-diirh-g-a-bargnr-leben-und-werk-des-.jpg?quality=85)