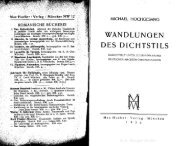Diplomarbeit - Leben und Werk des Dichters Gottfried August Bürger
Diplomarbeit - Leben und Werk des Dichters Gottfried August Bürger
Diplomarbeit - Leben und Werk des Dichters Gottfried August Bürger
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
54<br />
Jahre, das Fremde in ganzer Kraft zu empfangen, das Einheimische damit auszugleichen. Dafür wird<br />
dem Landmann gelehrt, was er nicht braucht, Schreiben, Lesen, Rechnen, da er wenig Gutes mehr zu<br />
lesen, nichts aufzuschreiben <strong>und</strong> noch weniger zu berechnen hat. 213<br />
Hier klingt der Konflikt der modernen warenproduzierenden Wirtschaftsform mit der alten<br />
zünftischen Ordnung an, gleichzeitig wird die politische Macht als repressiv <strong>und</strong> unverhältnismäßig<br />
betrachtet. Unangemessenheit ist in Brentanos Aufsatz ein wichtiger Begriff, der stets im Hintergr<strong>und</strong><br />
mitschwingt. Was nicht aus der natürlichen Lage <strong>des</strong> Einzelnen herauskommt, ist ihm unangemessen<br />
<strong>und</strong> insofern künstlich <strong>und</strong> aufgesetzt.<br />
Der Aufsatz problematisiert dies auch als didaktisches Problem, „daß unwissende Vorsteher diese<br />
einzige uns übrige feste historische Wurzel ausreissen“. 214 Das Volkslied wird dabei als historische<br />
Wurzel sowohl <strong>des</strong> Volks, als auch der Kunst begriffen: „Ohne Volksthätigkeit ist kein Volkslied <strong>und</strong><br />
selten eine Volksthätigkeit ohne dieses“. 215 Die Praxis steht also in einem reziproken Verhältnis zur<br />
Volkspoesie, gerät einer der beiden Pole aus dem Gleichgewicht, ergibt sich eine verhängnisvolle<br />
Dynamik. Die Sammlung hat es also mit einem doppelten Traditionsverlust zu tun: Einerseits einem<br />
strukturellen (das Volk selbst in Struktur <strong>und</strong> Brauchtum), andererseits die Volkspoesie.<br />
Wenn Arnim bemerkt, dass „unsere gebildetere Zeiten bey der Vernachläßigung <strong>des</strong> ärmeren <strong>Leben</strong>s<br />
(denn das sind die unteren Klassen jetzt) so viele leere Kriegslieder entstehen sahen“ 216 , spricht er<br />
eine weitere Differenz an, nämlich die zwischen gebildet <strong>und</strong> ungebildet. Durch die Vernachlässigung<br />
der ungebildeten, ärmeren Schichten entstehe maximal „leere“ Poesie (man denke an den mit der<br />
Krone eingepflanzten Baum). Die Lieder sind „aus den Ohren <strong>des</strong> Volkes verklungen, den Gelehrten<br />
allein übrig blieben, die es nicht verstehen, alle Volksbücher sind fortdauernd blos von unwissenden<br />
Speculanten besorgt, von Regierungen willkührlich leichtsinnig beschränkt <strong>und</strong> verboten […].“ 217<br />
Hier steckt der Aufsatz gr<strong>und</strong>sätzliche Parameter <strong>des</strong> literarischen Fel<strong>des</strong> ab: Die Volkspoesie ist im<br />
Volk nur mehr schwer greifbar, die Gelehrten schätzen sie gering, die Editoren der Volksbücher <strong>und</strong><br />
Sammlungen vermarkten sie als niedere Literatur (<strong>und</strong> spielen damit den Gelehrten in die Hände),<br />
die Regierung zensiert <strong>und</strong> verbietet Kolportageliteratur <strong>und</strong> Einzelblattdrucke <strong>und</strong> Niederschriften<br />
alter Lieder. An dieser Stelle lobt Arnim die Volksbücher Tiecks <strong>und</strong> „würde der beiden Jahrgänge <strong>des</strong><br />
von Nicolai besorgten feinen Almanachs mit Lob erwähnen, wenn nicht durch die angehefteten<br />
schlechten Spässe, w<strong>und</strong>erliche Schreibart <strong>und</strong> Ironie gegen Herder die Wirkung dieser schätzbaren<br />
213 Arnim/Brentano: W<strong>und</strong>erhorn I, S. 421.<br />
214 Arnim/Brentano: W<strong>und</strong>erhorn I, S. 422.<br />
215 Arnim/Brentano: W<strong>und</strong>erhorn I, S. 423. – Ricklefs sieht in Selbsttätigkeit/Volkstätigkeit die zentralen<br />
Begriffe Arnims politischer <strong>und</strong> ästhetischer Philosophie. Demnach seien sowohl Revolution, als auch Reaktion<br />
jeweils keine aktiven Tätigkeiten mehr, sondern reaktive Bewegungen – die eben nicht die freie Tätigkeit <strong>des</strong><br />
Volkes realisieren. Vgl. Ricklefs: Geschichte, Volk, Verfassung, S. 69.<br />
216 Arnim/Brentano: W<strong>und</strong>erhorn I, S. 427.<br />
217 Arnim/Brentano: W<strong>und</strong>erhorn I, S. 429.




![ERNSTEN BALIADE DIIR(]H G. A. BÃRGnR. - Leben und Werk des ...](https://img.yumpu.com/50237579/1/190x146/ernsten-baliade-diirh-g-a-bargnr-leben-und-werk-des-.jpg?quality=85)