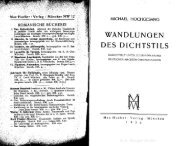Diplomarbeit - Leben und Werk des Dichters Gottfried August Bürger
Diplomarbeit - Leben und Werk des Dichters Gottfried August Bürger
Diplomarbeit - Leben und Werk des Dichters Gottfried August Bürger
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Durch diese Aufwertung <strong>des</strong> Begriffes ist für Herder auch klar, dass die Bestimmung <strong>des</strong><br />
Begriffsinhaltes von „Volk“ nicht beliebig sein kann <strong>und</strong> sie sich – im Interesse einer Bestimmung <strong>des</strong><br />
Begriffes als humanitäres Paradigma – nicht beliebig auf Unterschichten beziehen lässt:<br />
Zum Volkssänger gehört nicht, daß er aus dem Pöbel sein muß, oder für den Pöbel singt; so wenig es<br />
die edelste Dichtkunst beschimpft, daß sie im M<strong>und</strong>e <strong>des</strong> Volks tönet. Volk heißt nicht, der Pöbel auf<br />
den Gassen, der singt <strong>und</strong> dichtet niemals, sondern schreit <strong>und</strong> verstümmelt. 112<br />
Das Volk ist demnach nicht der Pöbel, Volkspoesie auch nicht Poesie für den Pöbel – damit kann<br />
keine ästhetische Synthese hergestellt werden. Herder spielt auf einen Mittellage an – Volkspoesie<br />
ist nicht niedere Literatur (wie Moritaten, Bänkelsang oder Schwänke, die sich in Nicolais Sammlung<br />
finden), aber auch nicht die hohe <strong>und</strong> elitäre Literatur der Orthodoxie; denn gerade das Tönen „im<br />
M<strong>und</strong>e <strong>des</strong> Volkes“, die Alltagspraxis, würden die spezifische Integrationskraft ausmachen. Damit<br />
sind „Volk“ <strong>und</strong> „Volkspoesie“ als Kippfiguren zwischen Unterschicht <strong>und</strong> Elite installiert: In<br />
Opposition zur Orthodoxie wird das Bild einer (freilich idealisierten) Unterschicht evoziert, während<br />
im Gegensatz dazu gleichzeitig die Bindung an die Unterschicht verneint wird. Es handelt sich also<br />
nicht nur um Lieder <strong>des</strong> Volkes, sondern auch um Lieder für das Volk.<br />
Kurioserweise wird dieser Kippmechanismus gerade von Nicolai in der Auseinandersetzung um die<br />
Volkslieder sehr deutlich erfasst. Nicolai, einflussreicher Verlagsbuchhändler <strong>und</strong> selbst Schriftsteller,<br />
stellt dabei eine Doppelgestalt dar, angesiedelt an der Grenze zwischen dem Feld der Kunst <strong>und</strong> der<br />
Ökonomie. Bourdieu beschreibt diese Vermittlungsinstanzen zwischen den Kreisen als<br />
„zwieschlächtig“ 113 , da gerade an Ihnen die unterschiedlich wirkenden Marktmechanismen deutlich<br />
werden. Friedrich Nicolai folgte mit Eyn feyner kleyner Almanach vol schönerr echterr liblicherr<br />
Volckslieder, lustigerr Reyen <strong>und</strong>dt kleglicherr Mordgeschichte, gesungen von Gabriel W<strong>und</strong>erlich<br />
weyl. Benkelsengernn zu Dessaw, herausgegeben von Daniel Seuberlich, Schusternn tzu Ritzmück ann<br />
der Elbe dem „Herderschen Aufruf zur Sammlung von Volks- <strong>und</strong> Provinzialliedern auf Straßen <strong>und</strong><br />
Fischmärkten treulicher […] als Herder selbst.“ 114 Darin hatte Nicolai – mit dem scheinbar gleichen<br />
Kriterium wie Herder, nämlich der alltagspraktischen Verwendung als Auswahlkriterium –<br />
unterschiedlichste Formen der Volkspoesie gesammelt <strong>und</strong> hält Herder diese – wie der<br />
archaisierende Titel zeigt – mit einiger Ironie entgegen. Er wirft Herder vor, man müsse sich erst<br />
112 Herder: Volkslieder, S. 239. – Hier widerspreche ich Rudolf Große, wenn er in der „soziologischen“<br />
Bedeutungsvariante <strong>des</strong> Volksbegriffes bei Herder eine „ausgesprochene Wertschätzung der Volksmassen“<br />
findet. (Große: „Volk“ bei Herder, S. 309). Große kommentiert die zitierte Stelle mit „die Eigenschaften sind<br />
aber nicht an Klassen <strong>und</strong> Stände geb<strong>und</strong>en“ <strong>und</strong> dem Argument hier überwiege die „moralische<br />
Wertkomponente“. (Große: „Volk“ bei Herder, S. 311). Dies überzeugt jedoch nicht <strong>und</strong> scheint mir Herder<br />
doch zu sehr zum Vorkämpfer der arbeitenden Klassen zu stilisieren. Dagegen vgl. auch Koepke: „Volk“ im<br />
Sprachgebrauch Herders, S. 211f. <strong>und</strong> S. 216, der eine Annäherung der „soziologischen“ an die „ethnische“<br />
Bedeutungsschicht annimmt <strong>und</strong> das Volk als „die große Masse der Menschen einer Gesellschaft“ identifiziert.<br />
113 Bourdieu: Regeln der Kunst, S. 239. Vgl. auch S. 343.<br />
114 Vgl. Gaier: Kommentar zu „Volkslieder“, S. 898.<br />
31




![ERNSTEN BALIADE DIIR(]H G. A. BÃRGnR. - Leben und Werk des ...](https://img.yumpu.com/50237579/1/190x146/ernsten-baliade-diirh-g-a-bargnr-leben-und-werk-des-.jpg?quality=85)