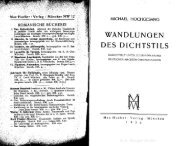Diplomarbeit - Leben und Werk des Dichters Gottfried August Bürger
Diplomarbeit - Leben und Werk des Dichters Gottfried August Bürger
Diplomarbeit - Leben und Werk des Dichters Gottfried August Bürger
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
50<br />
So ging es dem Herrlichen, während die schlechten Worte zum Theater sich erhoben, das damals mit<br />
Redensarten national werden wollte, in der That aber immer fremder wurde der Nation, zuletzt sich<br />
sogar einbildete über die Nation erhaben zu seyn (wohl einiger Fuß hoher Bretter willen, wie das<br />
Hochgericht über die Stadt). 192<br />
Die allgemeinen Redensarten, der Diskurs der Gebildeten, fühle sich immer erhaben <strong>und</strong> diese<br />
Distanz bleibt auch bestehen, wenn „der edle Klang diese schlechten Worte durch die Gassen“<br />
führt. 193 Hier klingt bereits die Differenz zwischen Kunstpoesie <strong>und</strong> Naturpoesie an, der „edle Klang“<br />
befördert letztlich eine schlechte Sache. So kommt er zu dem Schluss:<br />
Ein schönes Lied in schlechter Melodie behält sich nicht, <strong>und</strong> ein schlechtes Lied in schöner Melodie<br />
verhält sich <strong>und</strong> verfängt sich bis es herausgelacht; wie ein Labirinth ist es, einmal hinein, müssen wir<br />
wohl weiter, aber aus Furcht vor dem Lindwurm, der darin eingesperrt, suchen wir gleich nach dem<br />
ausleitenden Faden. So hat diese leere Poesie uns oft von der Musik vielleicht die Musik selbst<br />
herabgezogen. Neues muste [!] dem Neuen folgen, nicht weil die Neuen so viel Neues geben konnten,<br />
sondern weil so viel verlangt wurde: so war einmal einer leichtfertigen Art von Liedern zum Volke<br />
Bahn gemacht, die nie Volkslieder werden konnten. 194<br />
Die Verurteilung <strong>des</strong> „Wirbelwind <strong>des</strong> Neuen“ 195 beruht darauf, dass diese Lieder nicht mehr klingen<br />
können. Das Neue wird verlangt, der Markt diktiert - <strong>und</strong> nicht mehr das Empfinden. Interessant ist,<br />
dass Arnim auch neuen Liedern die Möglichkeit einräumt, Volkslieder zu werden. Es handelt sich also<br />
nicht um einen Korpus aus Vergangenem, sondern einem durchaus in die Gegenwart <strong>und</strong> Zukunft<br />
geöffneten Kontinuum.<br />
Den Ort, an dem solche Volkspoesie zu finden ist, steckt der Aufsatz sehr topisch ab – in einer<br />
Bildsprache, die bereits von Herder her bekannt ist. Arnim beschwört einen ländlichen locus<br />
amoenus, in der Natur werden Hofgesinde, Dorfleute, Soldaten, Bergleute <strong>und</strong> Handwerker als<br />
Träger <strong>des</strong> Liedgutes identifiziert. 196 Auffallend ist, dass Arnim das Volkslied kaum feminisiert – im<br />
Gegenteil ist das Bild, das er aufbaut, eher männlich konnotiert. Zwar wird im Zirkularbrief zur<br />
Volksliedsammlung gesagt, dass Frauen „meistens für frühere Eindrücke einer ungestörteren<br />
Erinnerung genießen, <strong>und</strong> besonders weibliche Dienstboten denselben ihre Gesänge lieber<br />
hersagen.“ 197 Doch lässt sich davon keine gr<strong>und</strong>sätzliche Feminisierung ableiten. Auch eine<br />
Abgrenzung <strong>des</strong> Volksbegriffes vom Pöbel scheint bei Arnim nicht mehr in extenso nötig. 198<br />
192 Arnim/Brentano: W<strong>und</strong>erhorn I, S. 408.<br />
193 Arnim/Brentano: W<strong>und</strong>erhorn I, S. 408.<br />
194 Arnim/Brentano: W<strong>und</strong>erhorn I, S. 408.<br />
195 Arnim/Brentano: W<strong>und</strong>erhorn I, S. 408.<br />
196 Vgl. Arnim/Brentano: W<strong>und</strong>erhorn I, S. 409. – Auch im Zirkularbrief zur Volksliedsammlung werden<br />
diejenigen, die „mit dem Landmann <strong>und</strong> den übrigen unteren Volksklassen in Berührung stehen“ aufgefordert<br />
Volkspoesie zu sammeln. (Arnim/Brentano: W<strong>und</strong>erhorn III, S. 350)<br />
197 Arnim/Brentano: W<strong>und</strong>erhorn III, S. 352.<br />
198 So kommt Gerhard vom Hofe durch eine Analyse von Lexika zu dem Schluss, dass diese Konnotation<br />
zunehmend wegfällt. Der Begriff scheint nicht zuletzt durch den literarischen Diskurs etabliert worden zu sein.<br />
So ist bei Campe 1811 „keine Verteidigung oder bewußte Aufwertung <strong>des</strong> Volksbegriffes mehr notwendig“.<br />
(Hofe: Volksgedanke in der Heidelberger Romantik, S. 233)


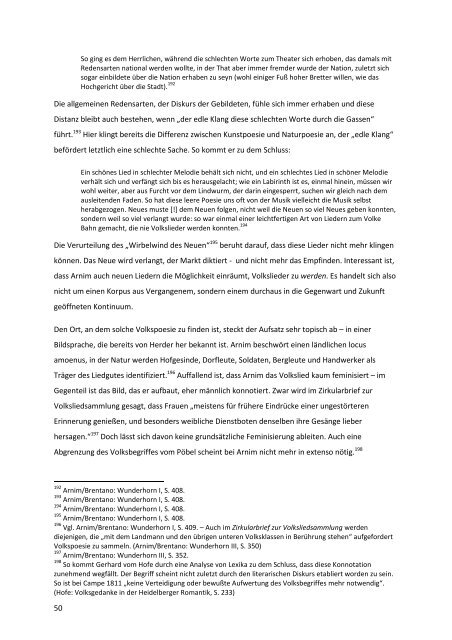

![ERNSTEN BALIADE DIIR(]H G. A. BÃRGnR. - Leben und Werk des ...](https://img.yumpu.com/50237579/1/190x146/ernsten-baliade-diirh-g-a-bargnr-leben-und-werk-des-.jpg?quality=85)