Aus der Arbeitsgruppe Immunologie der Tierärztlichen Hochschule ...
Aus der Arbeitsgruppe Immunologie der Tierärztlichen Hochschule ...
Aus der Arbeitsgruppe Immunologie der Tierärztlichen Hochschule ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
86<br />
KLIMEK und MALLING (1999) vertreten die Vorstellung, daß T-Lymphozyten für den<br />
Wirkmechanismus <strong>der</strong> Hyposensibiliserung eine zentrale Bedeutung besitzen. Insbeson<strong>der</strong>e T-<br />
Helferzellen des TH2-Typs, welche unter an<strong>der</strong>em Interleukin 4 und Interleukin 5 in hohem<br />
Maße produzieren, spielen für die Entwicklung, Aufrechterhaltung und <strong>Aus</strong>lösung einer<br />
Soforttypallergie eine essentielle Rolle. Nach ihrer Meinung veranlaßt eine<br />
Hyposensibilisierungstherapie eine Umorientierung <strong>der</strong> allergeninduzierten<br />
Lymphokinproduktion zu einem dominierenden TH1-Zytokinprofil. Da das Mengenverhältnis<br />
von Il-4 und seinem Regulator, Interferon-, das <strong>Aus</strong>maß <strong>der</strong> IgE-Synthese durch B-Zellen<br />
steuert, hat die Umorientierung eine vermin<strong>der</strong>te IgE-Produktion zur Folge. Inteferon-<br />
hemmt zusätzlich die Differenzierung von TH2-Zellen aus Vorläuferzellen; dadurch stehen<br />
weniger TH2-Zellen zur Verfügung, um B-Zellen Hilfe zur Produktion von IgE-Antikörpern<br />
zu leisten und um die Differenzierung von Mastzellen und Basophilen sowie die Anlockung,<br />
Differenzierung und Aktivierung von Eosinophilen zu ermöglichen.<br />
EBNER (1999) beschreibt, daß eine spezifische Immuntherapie (Hyposensibilisierung)<br />
beson<strong>der</strong>s bei allergischer Rhinokonjuktivitis und Asthma (VARNEY et al., 1991;<br />
BOUSQUET et al., 1987; D´AMANTO et al., 1995; BOUSQUET und MICHEL, 1994) mit<br />
Erfolg eingesetzt wird. Es handelt sich hierbei um die einzige Therapiemöglichkeit, welche<br />
nicht nur die Symptome bekämpft (DES ROCHES et al., 1997; JACOBSEN et al., 1996).<br />
Beim Vergleich von oraler, sublingualer und nasaler Therapiedurchführung variieren die<br />
Ergebnisse, abhängig von <strong>der</strong> verwendeten Methode und <strong>der</strong> eingesetzten Dosis. Bei <strong>der</strong><br />
nasalen und <strong>der</strong> sublingualen Therapie sind die Erfolgschancen vermutlich am größten<br />
(MOSBECH et al., 1987; SABBAH et al., 1994; ANDRI et al., 1995; WELSH et al., 1983).<br />
Der gemessene IgE-Spiegel fällt im Verlauf <strong>der</strong> Therapie nicht signifikant ab. Im Gegensatz<br />
dazu, fällt die IgG4-Konzentration konstant mit <strong>der</strong> Behandlung ab (DJURUP et al., 1984;<br />
EBNER et al., 1997). IgG4 hat keinen Einfluß auf die Komplementaktivierung (DJURUP et<br />
al., 1984; EBNER et al., 1997). Früher wurde IgG als „blockieren<strong>der</strong>“, das Allergen<br />
„neutralisieren<strong>der</strong>“ Antikörper, interpretiert (VAN DER ZEE und AALBERSE, 1987;<br />
LICHTENSTEIN et al., 1968; HUSSAIN et al., 1992). EBNER 1999 sieht genau wie<br />
KLIMEK und MALLING (1999) den entscheidenden Angriffspunkt <strong>der</strong> Therapie, welcher<br />
zum Therapieerfolg führt, auf <strong>der</strong> T-Zellebene.<br />
OKAZAKI et al. (1991) beobachteten bei Versuchen, mit spezifischer Immuntherapie, daß die<br />
Gesamtspiegel von IgG und IgE unter Therapie gleich bleiben, <strong>der</strong> IgG4-Spiegel sinkt jedoch<br />
unter Therapie signifikant ab.


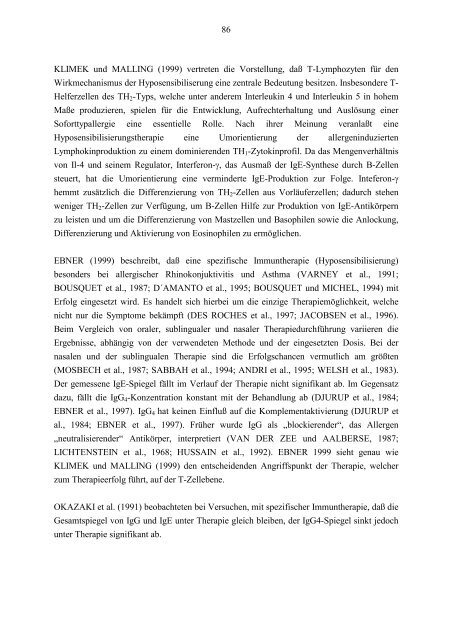



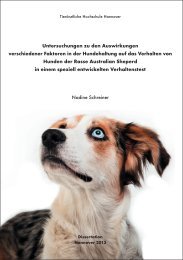



![Tmnsudation.] - TiHo Bibliothek elib](https://img.yumpu.com/23369022/1/174x260/tmnsudation-tiho-bibliothek-elib.jpg?quality=85)






