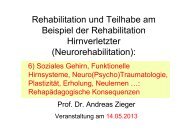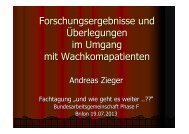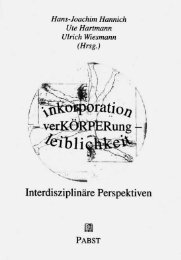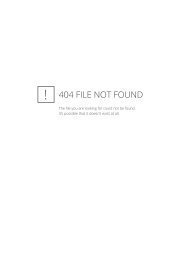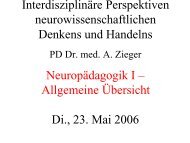PUA - Prof. Dr. med. Andreas Zieger
PUA - Prof. Dr. med. Andreas Zieger
PUA - Prof. Dr. med. Andreas Zieger
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
3. Empirie – Teil II<br />
oder allgemeiner formuliert zu autonom gestalteten Präsentationen einer bestimmten Thematik (…),<br />
die zunächst ohne weitere Interventionen von Seiten der InterviewerInnen produziert werden können.“<br />
(Rosenthal, 2011, S. 151) Diese Befragungstechnik wurde als Erhebungsinstrument für das Erst- und<br />
Kennlerngespräch gewählt, da es in Abgrenzung zur strukturierteren leidfadengestützten Interview-<br />
verfahren, die aufgrund einer Vorgabe von Themen und Begrifflichkeiten nur teilweise die subjektive<br />
Perspektive des Befragten erfassen (vgl. Küsters, 2009, S. 21), zu Beginn der Analyse eine offenere<br />
und unvoreingenommenere Haltung gegenüber dem Rehabilitanden gewährleisteten. Darüber hinaus<br />
wird in narrativen Interviews, laut Flick (vgl. 2011, S. 236), die Erzählung als Gestalt betont, die mehr<br />
umfasst als Aussagen und berichtete Fakten, sondern die Rekonstruktion von Verläufen in ihrer<br />
inneren Logik ermöglicht.<br />
Zur Generierung einer im narrativen Interview angestrebten „Stegreiferzählung“ (vgl. Przyborski &<br />
Wohlrab-Sahr, 2009, S. 93) ist der folgende „Erzählstimulus“ (vgl. Küsters, 2009, S. 55-57) für das<br />
Erst- und Kennlerngespräch vorbereitet worden:<br />
„Wir haben eine seltsame Frage … vielleicht eine etwas schwierigere Frage … und es benötigt<br />
eventuell auch ein bisschen Zeit zum Nachdenken, diese zu beantworten. Sie können sich<br />
dabei aber ruhig die Zeit nehmen, die sie möchten, auch für Einzelheiten, denn für uns ist alles<br />
das interessant, was ihnen wichtig ist. Für die Frage dürfen Sie sich gedanklich an die letzten<br />
Tage, Wochen und Monate zurückerinnern. Welcher bedeutende Gedanke hat Sie in dieser<br />
Zeit bis heute hauptsächlich beschäftigt? Wie würden Sie diesen Gedanken beschreiben?<br />
Wieso ist dieser Gedanke so bedeutend für Sie?“<br />
Diese Eingangsfrage musste allerdings nicht gestellt werden, da der Rehabilitand bereits gleich zu<br />
Beginn von sich aus und unaufgefordert von seinem Schlaganfall und seiner jetzigen Situation sowie<br />
den damit verbundenen Aspekten seines Lebens berichtete.<br />
Im Anschluss an seine Erzählungen, dessen Ende durch einen „Koda“ (vgl. Flick, 2011, S. 230;<br />
Przyborski & Wohlrab-Sahr, 2009, S. 228) signalisiert wurde, folgte der sogenannte narrative<br />
Nachfrageteil (vgl. Flick, 2011, S. 230; Przyborski & Wohlrab-Sahr, 2009, S. 99), in dem Ansätze zur<br />
Erzählungen, die bis dahin nicht weiter ausgeführt wurden, oder unklar gebliebene Passagen durch<br />
erneute Erzählaufforderungen von den Interviewern aufgegriffen worden sind (vgl. Flick, 2001, S.<br />
230). In dieser Phase des Interviewverlaufes wurden, unter Berücksichtigung der Person-Umfeld-<br />
Analyse, zusätzlich bereits erste, allgemeine Fragen zur Frau und Familie, zu den Freunden, zur<br />
Freizeit sowie zum Beruf an den Rehabilitanden gestellt.<br />
In der abschließenden „Bilanzierungsphase“ (vgl. Hussy, Schreier & Echterhoff, 2010, S. 218), die in<br />
den Nachfrageteil integriert war, wurde der Rehabilitand in Anlehnung an Hopf (vgl. 2009, S. 357) als<br />
Theoretiker seiner selbst angesprochen und auf abstrakter Ebene zu Generalisierungen und<br />
Selbstinterpretationen seiner Ausführungen gebeten. Zudem unterzeichnete er am Ende des Erst- und<br />
19