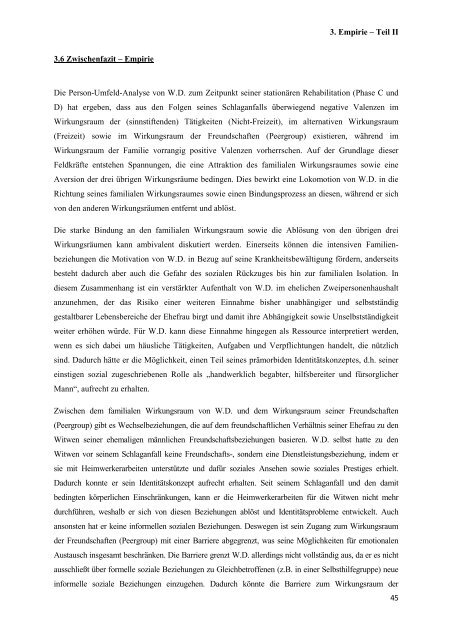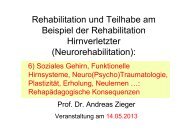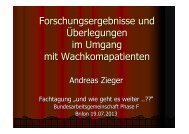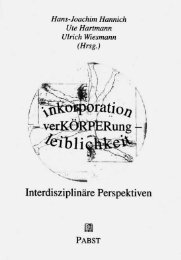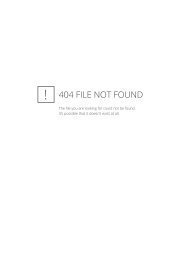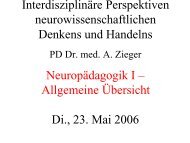PUA - Prof. Dr. med. Andreas Zieger
PUA - Prof. Dr. med. Andreas Zieger
PUA - Prof. Dr. med. Andreas Zieger
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
3.6 Zwischenfazit – Empirie<br />
3. Empirie – Teil II<br />
Die Person-Umfeld-Analyse von W.D. zum Zeitpunkt seiner stationären Rehabilitation (Phase C und<br />
D) hat ergeben, dass aus den Folgen seines Schlaganfalls überwiegend negative Valenzen im<br />
Wirkungsraum der (sinnstiftenden) Tätigkeiten (Nicht-Freizeit), im alternativen Wirkungsraum<br />
(Freizeit) sowie im Wirkungsraum der Freundschaften (Peergroup) existieren, während im<br />
Wirkungsraum der Familie vorrangig positive Valenzen vorherrschen. Auf der Grundlage dieser<br />
Feldkräfte entstehen Spannungen, die eine Attraktion des familialen Wirkungsraumes sowie eine<br />
Aversion der drei übrigen Wirkungsräume bedingen. Dies bewirkt eine Lokomotion von W.D. in die<br />
Richtung seines familialen Wirkungsraumes sowie einen Bindungsprozess an diesen, während er sich<br />
von den anderen Wirkungsräumen entfernt und ablöst.<br />
Die starke Bindung an den familialen Wirkungsraum sowie die Ablösung von den übrigen drei<br />
Wirkungsräumen kann ambivalent diskutiert werden. Einerseits können die intensiven Familien-<br />
beziehungen die Motivation von W.D. in Bezug auf seine Krankheitsbewältigung fördern, anderseits<br />
besteht dadurch aber auch die Gefahr des sozialen Rückzuges bis hin zur familialen Isolation. In<br />
diesem Zusammenhang ist ein verstärkter Aufenthalt von W.D. im ehelichen Zweipersonenhaushalt<br />
anzunehmen, der das Risiko einer weiteren Einnahme bisher unabhängiger und selbstständig<br />
gestaltbarer Lebensbereiche der Ehefrau birgt und damit ihre Abhängigkeit sowie Unselbstständigkeit<br />
weiter erhöhen würde. Für W.D. kann diese Einnahme hingegen als Ressource interpretiert werden,<br />
wenn es sich dabei um häusliche Tätigkeiten, Aufgaben und Verpflichtungen handelt, die nützlich<br />
sind. Dadurch hätte er die Möglichkeit, einen Teil seines prämorbiden Identitätskonzeptes, d.h. seiner<br />
einstigen sozial zugeschriebenen Rolle als „handwerklich begabter, hilfsbereiter und fürsorglicher<br />
Mann“, aufrecht zu erhalten.<br />
Zwischen dem familialen Wirkungsraum von W.D. und dem Wirkungsraum seiner Freundschaften<br />
(Peergroup) gibt es Wechselbeziehungen, die auf dem freundschaftlichen Verhältnis seiner Ehefrau zu den<br />
Witwen seiner ehemaligen männlichen Freundschaftsbeziehungen basieren. W.D. selbst hatte zu den<br />
Witwen vor seinem Schlaganfall keine Freundschafts-, sondern eine Dienstleistungsbeziehung, indem er<br />
sie mit Heimwerkerarbeiten unterstützte und dafür soziales Ansehen sowie soziales Prestiges erhielt.<br />
Dadurch konnte er sein Identitätskonzept aufrecht erhalten. Seit seinem Schlaganfall und den damit<br />
bedingten körperlichen Einschränkungen, kann er die Heimwerkerarbeiten für die Witwen nicht mehr<br />
durchführen, weshalb er sich von diesen Beziehungen ablöst und Identitätsprobleme entwickelt. Auch<br />
ansonsten hat er keine informellen sozialen Beziehungen. Deswegen ist sein Zugang zum Wirkungsraum<br />
der Freundschaften (Peergroup) mit einer Barriere abgegrenzt, was seine Möglichkeiten für emotionalen<br />
Austausch insgesamt beschränken. Die Barriere grenzt W.D. allerdings nicht vollständig aus, da er es nicht<br />
ausschließt über formelle soziale Beziehungen zu Gleichbetroffenen (z.B. in einer Selbsthilfegruppe) neue<br />
informelle soziale Beziehungen einzugehen. Dadurch könnte die Barriere zum Wirkungsraum der<br />
45