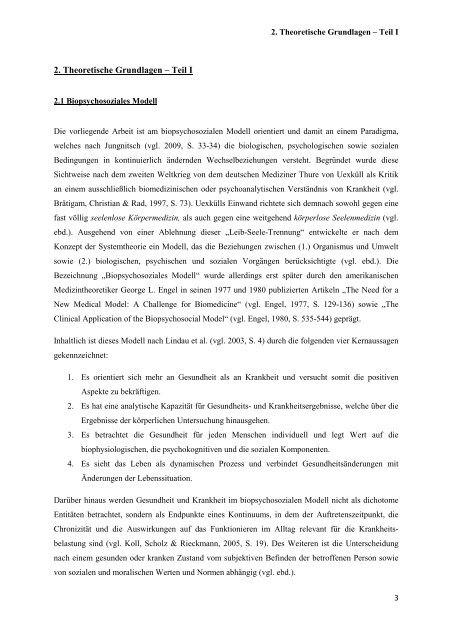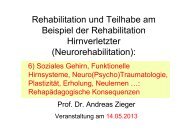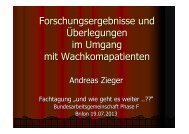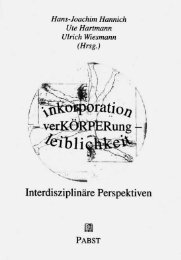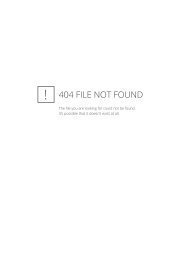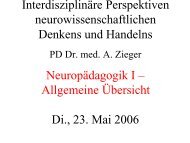PUA - Prof. Dr. med. Andreas Zieger
PUA - Prof. Dr. med. Andreas Zieger
PUA - Prof. Dr. med. Andreas Zieger
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
2. Theoretische Grundlagen – Teil I<br />
2.1 Biopsychosoziales Modell<br />
2. Theoretische Grundlagen – Teil I<br />
Die vorliegende Arbeit ist am biopsychosozialen Modell orientiert und damit an einem Paradigma,<br />
welches nach Jungnitsch (vgl. 2009, S. 33-34) die biologischen, psychologischen sowie sozialen<br />
Bedingungen in kontinuierlich ändernden Wechselbeziehungen versteht. Begründet wurde diese<br />
Sichtweise nach dem zweiten Weltkrieg von dem deutschen Mediziner Thure von Uexküll als Kritik<br />
an einem ausschließlich bio<strong>med</strong>izinischen oder psychoanalytischen Verständnis von Krankheit (vgl.<br />
Brätigam, Christian & Rad, 1997, S. 73). Uexkülls Einwand richtete sich demnach sowohl gegen eine<br />
fast völlig seelenlose Körper<strong>med</strong>izin, als auch gegen eine weitgehend körperlose Seelen<strong>med</strong>izin (vgl.<br />
ebd.). Ausgehend von einer Ablehnung dieser „Leib-Seele-Trennung“ entwickelte er nach dem<br />
Konzept der Systemtheorie ein Modell, das die Beziehungen zwischen (1.) Organismus und Umwelt<br />
sowie (2.) biologischen, psychischen und sozialen Vorgängen berücksichtigte (vgl. ebd.). Die<br />
Bezeichnung „Biopsychosoziales Modell“ wurde allerdings erst später durch den amerikanischen<br />
Medizintheoretiker George L. Engel in seinen 1977 und 1980 publizierten Artikeln „The Need for a<br />
New Medical Model: A Challenge for Bio<strong>med</strong>icine“ (vgl. Engel, 1977, S. 129-136) sowie „The<br />
Clinical Application of the Biopsychosocial Model“ (vgl. Engel, 1980, S. 535-544) geprägt.<br />
Inhaltlich ist dieses Modell nach Lindau et al. (vgl. 2003, S. 4) durch die folgenden vier Kernaussagen<br />
gekennzeichnet:<br />
1. Es orientiert sich mehr an Gesundheit als an Krankheit und versucht somit die positiven<br />
Aspekte zu bekräftigen.<br />
2. Es hat eine analytische Kapazität für Gesundheits- und Krankheitsergebnisse, welche über die<br />
Ergebnisse der körperlichen Untersuchung hinausgehen.<br />
3. Es betrachtet die Gesundheit für jeden Menschen individuell und legt Wert auf die<br />
biophysiologischen, die psychokognitiven und die sozialen Komponenten.<br />
4. Es sieht das Leben als dynamischen Prozess und verbindet Gesundheitsänderungen mit<br />
Änderungen der Lebenssituation.<br />
Darüber hinaus werden Gesundheit und Krankheit im biopsychosozialen Modell nicht als dichotome<br />
Entitäten betrachtet, sondern als Endpunkte eines Kontinuums, in dem der Auftretenszeitpunkt, die<br />
Chronizität und die Auswirkungen auf das Funktionieren im Alltag relevant für die Krankheits-<br />
belastung sind (vgl. Koll, Scholz & Rieckmann, 2005, S. 19). Des Weiteren ist die Unterscheidung<br />
nach einem gesunden oder kranken Zustand vom subjektiven Befinden der betroffenen Person sowie<br />
von sozialen und moralischen Werten und Normen abhängig (vgl. ebd.).<br />
3