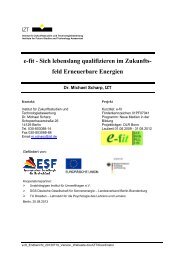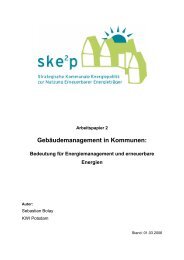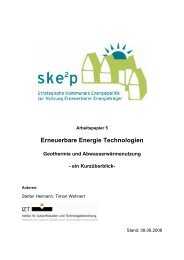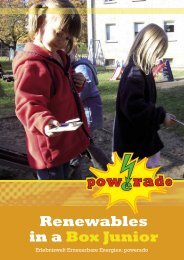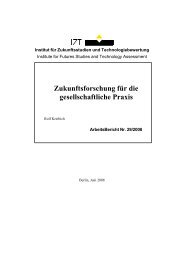Download - IZT
Download - IZT
Download - IZT
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Einleitung <strong>IZT</strong> Seite: 13<br />
3. Die Frage, inwieweit neue Online- und Mobilangebote das Kauf- und Produktnutzungsverhalten<br />
verändern, welche ökologischen und soziale Effekte damit verbunden<br />
sind und wie dies von Anbietern im Rahmen von Innovationsprozessen berücksichtigt<br />
werden kann, findet bislang kaum Aufmerksamkeit.<br />
Während für die Investitionsgüterindustrie bereits seit den 70er Jahren Modelle der Hersteller-<br />
Kunden-Interaktion im Innovationsprozess entwickelt worden sind 14 , liegen für den<br />
Konsumgüterbereich erst seit kurzem konzeptionelle und methodische Überlegungen vor. 15 Mit<br />
Blick auf die Entwicklung von Online- und Mobilangeboten, die zu nachhaltigen Produktnutzungssystemen<br />
beitragen, weist der derzeitige Stand der Innovationsforschung drei zentrale<br />
Defizite auf:<br />
1. Im Gegensatz zur Investitionsgüterindustrie sind die praktischen Erfahrungen mit der aktiven<br />
Einbindung von Kunden in Innovationsprozesse des Konsumgüterbereichs noch gering.<br />
Insbesondere die methodischen Vorschläge zur Identifizierung und Abgrenzung von<br />
„fortschrittlichen Kunden“ sind bislang noch lückenhaft. Bezüge zu Ansätzen der Zielgruppensegmentierung<br />
aus der Lebensstil- und Konsumstilforschung (Sinus-Milieus etc.) werden<br />
bis dato nicht hergestellt.<br />
2. Die Ansätze zur Gestaltung von Kunden-Hersteller-Interaktionen im Innovationsprozess<br />
konzentrieren sich bis dato vorrangig auf physische Konsumgüter (Sportbekleidung etc.).<br />
Inwieweit diese Ansätze auf die Entwicklung grundlegend neuer Online- und Mobilangebote<br />
übertragbar sind, ist noch nicht untersucht. 16<br />
3. Bisherige Ansätze der Kundenintegration werden ausschließlich unter marktstrategischen<br />
Gesichtspunkten (Sicherung von Marktakzeptanz, Reduzierung des Floprisikos etc.)<br />
betrachtet. Die Möglichkeit, durch die Einbeziehung der Nutzeranforderungen und des<br />
Nutzerverhaltens frühzeitig ökologische oder soziale Chancen und Risiken von Innovationsvorhaben<br />
einbeziehen zu können, werden bis dato kaum aufgegriffen.<br />
Vor diesem Hintergrund sind im Rahmen dieser Studie in erster Linie konzeptionelle und<br />
theoretische Integrationsleistungen zu erbringen. Dazu sind die theoretischen und konzeptionellen<br />
Angebote der einzelnen Forschungsstränge vertiefend zu analysieren, Anschlussstellen zu<br />
prüfen und Integrationsansätzte zu entwickeln.<br />
14 Vgl. hierzu insbesondere das „Lead user“-Konzept von Hippel (1988) sowie das Zusammenarbeitsmodell<br />
von Gemünden (1981).<br />
15 Vgl. dazu insb. Lüthje 2000.<br />
16 Die sich im Zuge von E-Business-Lösungen verändernden Anbieter-Nachfrager-Interaktionen (z.B.<br />
durch Costumer-Relationship-Managementsysteme), werden bis dato lediglich auf die kontinuierliche<br />
Anpassung und von Angeboten auf die Kundenpräferenzen bezogen (inkrementelle Verbesserungen)<br />
(vgl. Wirtz 2001, 516), nicht aber auf grundlegende Produkt- oder Serviceinnovationen.