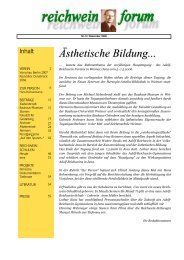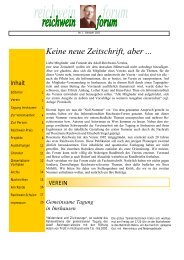„Richte immer die Gedanken... - Adolf-Reichwein-Verein
„Richte immer die Gedanken... - Adolf-Reichwein-Verein
„Richte immer die Gedanken... - Adolf-Reichwein-Verein
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
eichwein forum Nr. 17/18 Mai 2012<br />
11<br />
Wechsels, eine entspannende Wanderung<br />
im Löwenberger Land.<br />
Jedes Arbeitslager endete mit einem<br />
großen gemeinsamen Abschlussabend<br />
bei dem jeder Teilnehmer durch Darbietungen<br />
zur Unterhaltung Beiträge<br />
lieferte, beziehungsweise liefern<br />
musste.<br />
Mit dem dritten Arbeitslager 1930 endete<br />
jedoch <strong>die</strong> Reihe <strong>die</strong>ser Veranstaltungen<br />
im Boberhaus. Die Gründe<br />
dafür sind nicht ganz klar. Es wird berichtet,<br />
es habe 1930 Unstimmigkeiten<br />
zwischen der Jungmannschaft und Rosenstock<br />
gegeben, durch <strong>die</strong> Rosenstock<br />
aus der Arbeit des Boberhauses<br />
gedrängt wurde. 12<br />
Im Herbst 1930 fand in Hankensbüttel<br />
in der Lüneburger Heide, von Teilnehmern<br />
des Frühjahrs-Arbeitslagers<br />
im Boberhaus unter Mithilfe Rosenstocks<br />
veranstaltet, noch das "erste<br />
norddeutsche Arbeitslager für Arbeiter,<br />
Bauern und Studenten" statt, es<br />
folgten im Frühjahr 1931 trotz der<br />
durch <strong>die</strong> Wirtschaftskrise erschwerten<br />
Bedingungen, zwei weitere Lager<br />
in Brandenburg. Auch in Hessen, Bayern<br />
und im Rheinland führte man in<br />
<strong>die</strong>sen Jahren Arbeitslager durch und<br />
knüpfte dabei bewusst an <strong>die</strong> Erfahrungen<br />
im Boberhaus an.<br />
Erwähnt werden soll, dass Hans Raupach<br />
1932 aus Mitteln der Abraham-<br />
Lincoln-Foundation, zu deren Beratern<br />
auch <strong>Reichwein</strong>, Hans Simons und C.H.<br />
Becker gehörten, <strong>die</strong> Möglichkeit erhielt,<br />
in Berlin eine „Mittelstelle für<br />
Arbeits<strong>die</strong>nst in Volkslagern“ aufzubauen,<br />
mit der <strong>die</strong> Arbeitslagerbewegung<br />
koordiniert werden sollte – leider<br />
zu spät, denn der Charakter der<br />
bündischen und pädagogischen Lagerbewegung<br />
begann sich bereits deutlich<br />
in Richtung auf den Freiwilligen<br />
Arbeits<strong>die</strong>nst zu verschieben, was sich<br />
nicht nur auf <strong>die</strong> Zusammensetzung<br />
der Teilnehmerschaft auswirkte, son-<br />
12 Rosenstocks Meinung vom bildnerischen Engagement<br />
der Jugendbewegung scheint ein wenig<br />
herablassend gewesen zu sein. So schreibt<br />
er in seinem erwähnten Buch „Ein Arbeitslager...(1931)“,<br />
dass er mit seiner Arbeit <strong>die</strong> bündischen<br />
Arbeitslager „aus dem Hag gelassener<br />
Muße herausgenommen“ habe. Diese Äußerung<br />
hatte viel Unmut erzeugt.<br />
dern auch eine Verschiebung zu Gunsten<br />
des körperlichen Arbeitens bedeutete..<br />
Die Lage des Boberhauses<br />
verschlechterte<br />
sich zusehends.<br />
1933 wurde das Haus<br />
vom Reichskommissar<br />
für den freiwilligen<br />
Arbeits<strong>die</strong>nst zu einer<br />
der Führerschulen bestimmt.<br />
Der letzte reguläre<br />
Lehrgang des<br />
Boberhauses endete<br />
im April 1933, dem<br />
Jahr, in dem Rosenstock<br />
Deutschland<br />
verließ und in <strong>die</strong> USA<br />
emigrierte. Es hat<br />
dann zwar noch weitere Bildungs- und<br />
Schulungsveranstaltungen unter NS-<br />
Bedingungen gegeben, aber <strong>die</strong>ses<br />
fällt nicht mehr unter das Thema<br />
"freie Volksbildung".<br />
1937 enteigneten <strong>die</strong> Nazis das Haus.<br />
Bei den Kämpfen um Löwenberg wurde<br />
das Boberhaus, in dem zuletzt lothringische<br />
Zwangsarbeiter gewohnt<br />
hatten, Anfang Februar 1945 von einer<br />
sowjetischen Artilleriegranate getroffen,<br />
in dem Versuch, <strong>die</strong> benachbarte<br />
Chemiefabrik zu zerstören. Um<br />
Baumaterial zum Wiederaufbau Löwenbergs<br />
zu gewinnen, trug man das<br />
brandgeschädigte Haus nach zunehmendem<br />
Verfall bald bis auf <strong>die</strong> beiden<br />
Sockelgeschosse ab und machte<br />
es endgültig zur Ruine. Das Grundstück<br />
steht heute in Privatbesitz. 13<br />
Beispiel 2: „Geistige Kolonisierung<br />
des Ostraumes“ - Ein Heim für <strong>die</strong><br />
Musik<br />
Was vom Boberhaus blieb.<br />
Ganz anders <strong>die</strong> Geschichte des Musikheims.<br />
Hier begegnet uns eine<br />
staatliche Einrichtung mit eigens errichtetem<br />
neuen Gebäude. Drei Persönlichkeiten<br />
sind hier prägend: Georg<br />
Götsch, Carl Heinrich Becker – der sich<br />
selbst auch als einer der Väter des<br />
Boberhauses bezeichnete, und der<br />
13 Wrzesiński, Szymon: Pełen tajemnic Dom nad<br />
Bobrem; http://facet.interia.pl/<br />
Engländers Rolf Gardiner 14 . Letzterer,<br />
weil er von Anfang an das Haus als<br />
Ideengeber, Mitveranstalter und Vermittler<br />
begleitete. Vor allem durch<br />
seine Austauschreisen deutscher und<br />
englischer Gruppen hat er zu einer beträchtlichen<br />
Ausweitung der Aktivitäten<br />
des Musikheims beigetragen.<br />
Georg Götsch<br />
Georg Götsch, Jahrgang 1895, stammt<br />
aus einfachen Verhältnissen. Ohne<br />
Abitur wurde er Volksschullehrer, war<br />
dann Wandervogel und Wandervogelführer<br />
und wurde zu einer bedeutenden<br />
Persönlichkeit der deutschen Jugendbewegung<br />
und der Jugendmusikbewegung.<br />
Kriegsfreiwilliger, Kriegsge-<br />
14<br />
Georg Götsch: Lebenszeichen. Zeugnisse eines<br />
Weges. Hrsg. von Erich Bitterhof. Wolfenbüttel:<br />
Möseler 1969; 356 S.<br />
Foto: Szymon Wrzesiński