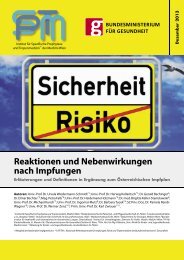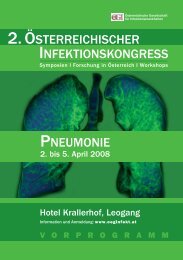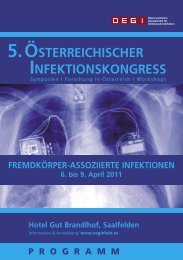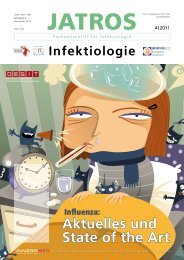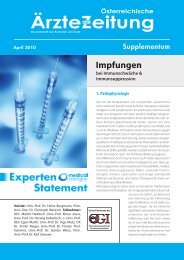Helicobacter pylori: - Österreichische Gesellschaft für ...
Helicobacter pylori: - Österreichische Gesellschaft für ...
Helicobacter pylori: - Österreichische Gesellschaft für ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Konsensus<br />
Infektiologie<br />
Staphylococcus aureus<br />
Konsensus: Therapie mit<br />
alten Antibiotika<br />
Neue Antibiotika müssen keineswegs immer besser sein als alte – teurer<br />
sind sie jedoch fast immer. Ein österreichischer infektiologischer Konsensus<br />
beleuchtet nun die Möglichkeiten einer Therapie von Staphylococcus aureus-<br />
Infektionen mit älteren, schmäler wirksamen Antibiotika. Diese Möglichkeiten<br />
sind durchaus attraktiv und oftmals auch ökonomisch sinnvoll.<br />
Ein 2013 unter der Patronanz der<br />
ÖGIT sowie der Österreichischen <strong>Gesellschaft</strong><br />
für antimikrobielle Chemotherapie<br />
(ÖGACH) publiziertes Konsensusdokument<br />
befasste sich mit der<br />
Therapie von Staphylococcus aureus-<br />
Infektionen mit älteren Antibiotika.<br />
Dies sind vor allem bestimmte Betalaktame,<br />
weiters Clindamycin, Fosfomycin,<br />
Fusidinsäure, Tetrazykline und<br />
Kombinationen von Trimethoprim<br />
mit einem Sulfonamid.<br />
Resistenzlage<br />
Die Rate von MRSA (methicillinresistentem<br />
Staphylococcus aureus) liegt<br />
in Österreich derzeit bei ca. 8%. In<br />
den letzten Jahren war diesbezüglich<br />
in Europa und speziell auch in Österreich<br />
ein rückläufiger Trend zu beobachten.<br />
Die Rate der Resistenz von<br />
KeyPoints<br />
S. aureus gegen Makrolide liegt hierzulande<br />
bei maximal 16%. Bei den<br />
Fluorchinolonen, die nicht primär zur<br />
Therapie von Staphylokokkeninfektionen<br />
verwendet werden sollen, variieren<br />
die Resistenzraten zwischen 10%<br />
(Levofloxacin) und 75% (Ofloxacin).<br />
Sehr niedrig sind die Raten der Resistenz<br />
von S. aureus gegen Gentamicin<br />
(4%), Fusidinsäure (1%) und Rifampicin<br />
(0,7%). Gegen Vancomycin und<br />
Linezolid wurden bei S. aureus in Österreich<br />
bisher keine Resistenzen festgestellt.<br />
Auch die Raten der Resistenz<br />
gegen Teicoplanin, Daptomycin und<br />
Fosfomycin liegen unter 1%.<br />
Krankheitsbilder<br />
• Niedrige S. aureus-Resistenzraten in Österreich gegen Gentamicin, Fusidinsäure, Rifampicin,<br />
Vancomycin, Linezolid, Teicoplanin, Daptomycin und Fosfomycin<br />
• Mögliche alte Antibiotika gegen S. aureus: Flucloxacillin, Cefazolin, Clindamycin, Fusidinsäure,<br />
Trimethoprim plus Sulfonamid sowie Doxycyclin und Minocyclin<br />
• Rifampicin und Fosfomycin jeweils nur in Kombination mit einer anderen Substanz verabreichen!<br />
• Verwendung alter Antibiotika gegen S. aureus sowohl ökonomisch als auch mit Blick auf<br />
„Anti microbial Stewardship“ sinnvoll<br />
Eine Kolonisation mit Staphylokokken<br />
ist häufig, wobei der natürliche<br />
Standort von S. aureus die Nasenschleimhaut<br />
ist, während die gesunde<br />
Haut nur passager besiedelt wird. In<br />
der Normalbevölkerung liegt bei 16<br />
bis 20% eine permanente, bei 50 bis<br />
70% eine passagere Besiedelung mit<br />
S. aureus vor. Abhängig von Alter, Geschlecht,<br />
genetischen Faktoren (HLA-<br />
Muster), Grunderkrankung (z.B. Diabetes<br />
mellitus, chronische Ekzeme,<br />
atopische Diathese) und Hospitalisierungsstatus<br />
kann das Besiedelungsmuster<br />
unterschiedlich sein. Eine Besiedelung<br />
mit S. aureus hat per se noch<br />
keinen Krankheitswert, führt jedoch zu<br />
einem erhöhten Risiko, eine Infektion<br />
zu entwickeln. Insbesondere handelt<br />
es sich hier um Haut- und Weichteilinfektionen,<br />
z.B. bei gestörter Barrierefunktion<br />
der Haut. Die Übertragung<br />
kann durch direkten Kontakt oder Autoinokulation<br />
erfolgen. Direkter Kontakt<br />
kann als Schmierinfektion über<br />
infizierte bzw. kolonisierte Menschen<br />
oder Tiere (sowohl Haus- als auch<br />
Masttiere) erfolgen, weiters über kontaminierte<br />
Oberflächen oder Wäsche.<br />
Unter Auto inokulation ist die endogene<br />
Infektion aus dem eigenen Nasen-<br />
Rachen-Raum zu verstehen.<br />
Zu den durch S. aureus verursachten<br />
Krankheitsbildern zählen pyogene Infektionen,<br />
Fremdkörper-assoziierte Infektionen,<br />
systemische Infektionen und<br />
Toxin-vermittelte Syndrome. Der soge<br />
3/13 Infektiologie & Gastroenterologie-Hepatologie Seite 21 I jatros