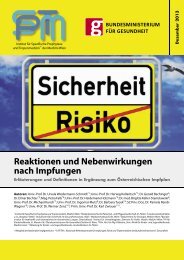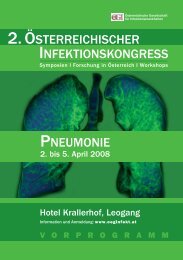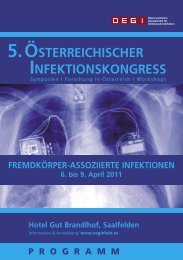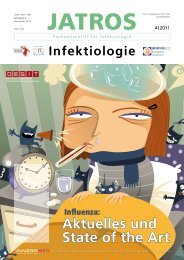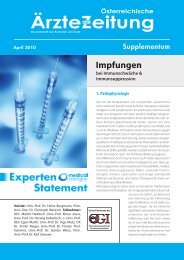Helicobacter pylori: - Österreichische Gesellschaft für ...
Helicobacter pylori: - Österreichische Gesellschaft für ...
Helicobacter pylori: - Österreichische Gesellschaft für ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Hepatologie<br />
Referat<br />
epidemiologische Daten beschreiben<br />
eine Prävalenz der NAFLD von 41%<br />
in westlichen Populationen, 1–5% aller<br />
Patienten dürften von der eher progredient<br />
verlaufenden Form (NASH) betroffen<br />
sein. Bedauerlicherweise ist es<br />
derzeit weder bildgebend noch laborchemisch<br />
möglich, die „unkomplizierte“<br />
NAFL von der NASH zu differenzieren,<br />
sodass die Leberhistologie nach<br />
wie vor den „Goldstandard“ in der Diagnostik<br />
darstellt. In den letzten Jahren<br />
hat sich sowohl in populationsbasierten<br />
Untersuchungen als auch in Studien, die<br />
den natürlichen Verlauf der NAFLD beleuchteten,<br />
gezeigt, dass Patienten mit<br />
einer Fettlebererkrankung ein höheres<br />
Risiko haben, an kardiovaskulären Erkrankungen<br />
zu sterben, und signifikant<br />
höhere tumor- und leberassoziierte<br />
Mortalität aufweisen. Besorgniserregend<br />
ist, dass es in den letzten Jahren<br />
zu einer dramatischen Zunahme von<br />
NAFLD-assoziierten hepatozellulären<br />
Karzinomen gekommen ist. Bemerkenswert<br />
dabei ist auch, dass das NAFLDassoziierte<br />
HCC nicht nur in der<br />
zirrhotischen Leber, sondern überproportional<br />
häufig auch bei NASH ohne<br />
Zirrhose und, wenngleich selten, sogar<br />
bei Patienten mit „simpler“ Steatose<br />
auftreten kann. Derzeit ist die NAFLD<br />
mit komplizierter Verlaufsform wie Zirrhose<br />
und/oder HCC die dritthäufigste<br />
Indikation für eine Lebertransplantation.<br />
Es ist davon auszugehen, dass die<br />
Abb. 1: NAFLD<br />
NAFLD in den nächsten 10 Jahren die<br />
häufigste Indikation für eine Lebertransplantation<br />
darstellen wird. Auf<br />
Basis epidemiologischer Daten existiert<br />
aber nicht nur ein klarer Zusammenhang<br />
zwischen Fettlebererkrankung<br />
und HCC, sondern auch mit dem Kolorektalkarzinom.<br />
So konnten Stadlmayr<br />
et al zeigen, dass die NAFLD ein unabhängiger<br />
Risikofaktor für kolorektale<br />
Adenome und Karzinome darstellt. 2<br />
Daten aus Asien zeigen darüber hinaus,<br />
dass Patienten mit NASH im Vergleich<br />
zu Lebergesunden wesentlich häufiger<br />
fortgeschrittene Adenome entwickelten<br />
und diese Adenome auch häufiger im<br />
rechten Hemikolon auftraten. 3<br />
Natürlicher Verlauf und Erkrankungsprogression<br />
der NAFLD<br />
Der natürliche Verlauf der NAFLD und<br />
vor allem Faktoren, die zu einem Fortschreiten<br />
der Erkrankung führen, sind<br />
nur unzureichend aufgeklärt. Die Insulinresistenz<br />
steht jedoch im Fokus von<br />
Entstehung und Erkrankungsprogression.<br />
Die Insulinresistenz beeinflussende,<br />
komplexe Interaktionen zwischen<br />
genetischen Faktoren, Ernährungsgewohnheiten,<br />
Adipozytokinen und dem<br />
in letzter Zeit zunehmend in den Fokus<br />
des wissenschaftlichen Interesses geratenen<br />
intestinalen Mikrobiom spielen dabei<br />
im natürlichen Verlauf eine zentrale<br />
Rolle. So konnte in mehreren Studien<br />
gezeigt werden, dass das Ausmaß der<br />
Insulinresistenz mit dem Schweregrad<br />
histologischer Veränderungen, dem<br />
Auftreten von Zirrhose und HCC und<br />
daher mit Prognose und Mortalität klar<br />
assoziiert ist (Abb. 1).<br />
Metabolische Faktoren der NAFLDassoziierten<br />
Kanzerogenese<br />
Aus pathophysiologischer Sicht wird<br />
die Assoziation zwischen Übergewicht,<br />
Adipositas und Karzinogenese nur unvollständig<br />
verstanden. In den letzten<br />
Jahren ist es jedoch gelungen, einige<br />
wichtige Faktoren zu charakterisieren,<br />
die eine mögliche Verbindung zwischen<br />
metabolischem Syndrom, chronischer<br />
Inflammation und Kanzerogenese darstellen.<br />
Eine wesentliche Rolle bei diesen<br />
postulierten Mechanismen spielen<br />
die Hyperinsulinämie sowie „Insulinlike<br />
growth factor signaling“. Eine zentrale<br />
Rolle dürfte auch die viszerale<br />
Adipositas spielen, da sie nicht nur eine<br />
Quelle für eine systemische subklinische<br />
Inflammation darstellt, sondern auch<br />
für eine Dysbalance wichtiger, in den<br />
Adipozyten gebildeter Zytokine, wie<br />
Adiponektin und Leptin, verantwortlich<br />
ist. Adiponektin-Serumspiegel sind<br />
vor allem bei Patienten mit Adipositas,<br />
metabolischem Syndrom und Diabetes<br />
mellitus deutlich erniedrigt. So konnte<br />
auch gezeigt werden, dass eine inverse<br />
Korrelation zwischen Adiponektin und<br />
dem Auftreten kolorektaler Adenome<br />
besteht. In-vitro- und In-vivo-Studien<br />
zeigen, dass Adiponektin durch Modulation<br />
metabolischer und antiangiogenetischer<br />
Mechanismen in der Lage ist,<br />
das Wachstum von Kolonkarzinomzellen<br />
sehr potent zu inhibieren. 4 Andererseits<br />
konnte in mehreren Studien gezeigt<br />
werden, dass Leptin, ein weiteres Adipozytokin,<br />
welches bei Adipositas und<br />
metabolischem Syndrom fehlreguliert<br />
wird, in der Lage ist, das Wachstum<br />
verschiedener Krebszelllinien (in Brust,<br />
Ösophagus, Pankreas, Kolorektum,<br />
Prostata und Lunge) zu stimulieren.<br />
Obwohl diese Daten relativ präliminär<br />
sind, scheinen Adipozytokine attraktive<br />
Kandidaten zu sein, um den Zusammenhang<br />
zwischen Adipositas, metabolischem<br />
Syndrom und Kanzerogenese<br />
besser verstehen zu können.<br />
jatros I Seite 56<br />
3/13 Infektiologie & Gastroenterologie-Hepatologie