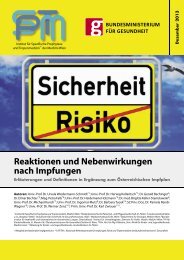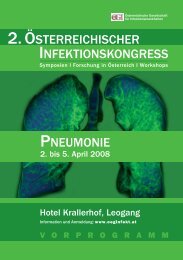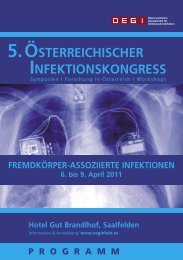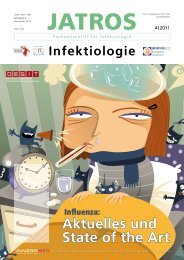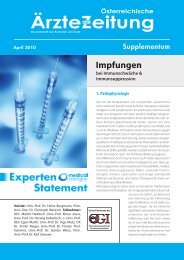Helicobacter pylori: - Österreichische Gesellschaft für ...
Helicobacter pylori: - Österreichische Gesellschaft für ...
Helicobacter pylori: - Österreichische Gesellschaft für ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
GASTROENTEROLOGIE<br />
der HP-Infektion und verschiedensten<br />
Krankheitsbildern beschrieben (M. Parkinson,<br />
M. Alzheimer, koronare Herzkrankheiten,<br />
Diabetes, Übergewicht,<br />
Hautläsionen wie chronische Urtikaria<br />
etc.), die jedoch keine klare Kausalität<br />
erkennen lassen.<br />
Diagnostische Methoden<br />
Zur Diagnostik einer HP-Infektion<br />
sind vor allem Testverfahren geeignet,<br />
die das Bakterium selbst (Histologie,<br />
Kultur), typische Antigene (im Stuhl)<br />
oder sehr spezifische Stoffwechselprodukte<br />
(Ammoniak beim Urease-<br />
Schnelltest, Kohlendioxid beim Atemtest)<br />
nachweisen.<br />
Neben diesen direkten Nachweisverfahren<br />
besteht auch die Möglichkeit<br />
des Nachweises spezifischer Antikörper<br />
(Blut, Serum, Speichel und Urin).<br />
Invasive Methoden<br />
Dabei werden im Rahmen einer Gastroduodenoskopie<br />
entnommene Biopsien<br />
untersucht. Urease-Schnelltests aus Antrumbiopsien<br />
weisen in der Regel eine<br />
exzellente Sensitivität und Spezifität auf<br />
und können teilweise schon nach wenigen<br />
Minuten abgelesen werden.<br />
Der kulturelle Erregernachweis ist das<br />
einzige Verfahren, das eine 100%ige<br />
Spezifität aufweist; unter optimalen<br />
Voraussetzungen (Probengewinnung<br />
und Transport, Analytik im Labor) ist<br />
auch die Sensitivität sehr hoch. Das<br />
Vorliegen des gezüchteten Erregers ermöglicht<br />
eine Vielzahl von Analysen,<br />
unter anderem auch die Empfindlichkeitsprüfung.<br />
Nicht invasive Methoden<br />
Nicht invasive Testmethoden umfassen<br />
Atemtests und Stuhlantigentests, die<br />
vor allem im Rahmen der Therapieverlaufskontrolle<br />
eingesetzt werden, sowie<br />
verschiedene Verfahren des Antikörpernachweises.<br />
Der Atemtest ist sicherlich der genaueste<br />
nicht invasive Test, der mit einem<br />
stabilen chemischen Reagenz (zumeist<br />
13<br />
C-Harnstoff) nach einem standardisierten<br />
Protokoll ein definiertes Enzym<br />
(Urease) nachweist.<br />
Gute Stuhlantigentests stehen dem<br />
Atemtest im Hinblick auf Sensitivität<br />
und Spezifität kaum nach. Es ist jedoch<br />
zu bedenken, dass es verschiedene<br />
Stuhlantigentests, sowohl quantitative<br />
laborbasierte Tests als auch Schnelltests,<br />
gibt. Über die verwendeten Antikörper<br />
und nachgewiesenen Antigene ist in der<br />
Regel wenig bis nichts bekannt. Vor der<br />
Entscheidung zur Anwendung solcher<br />
Tests sollten daher die Validierungsdaten<br />
geprüft werden.<br />
Ein weiterer Vorteil des Atemtests besteht<br />
darin, dass Atemluftproben leicht<br />
zu gewinnen sowie unproblematisch zu<br />
lagern sind und daher auch zur Analyse<br />
sehr einfach verschickt werden können.<br />
Beim Antigentest ist eine nicht selten<br />
vorhandene Aversion gegen Stuhlproben<br />
zu überwinden und auch eine allfällige<br />
Versandlogistik aufgrund der<br />
Notwendigkeit der Probenkühlung und<br />
der potenziellen Kontagiosität des Materials<br />
wesentlich aufwendiger.<br />
Für die Antikörperbestimmung kommen<br />
nur gut evaluierte, quantitative<br />
Tests aus Serum in Betracht. Generell<br />
hat die Serologie einen guten negativen<br />
Vorhersagewert. Serologische Tests sind<br />
wertvoll im Rahmen epidemiologischer<br />
Studien, im klinischen Alltag ist der Einsatz<br />
aber sehr begrenzt. Mögliche Indikationen<br />
sind Szenarien, bei denen auf<br />
Sensitivität (%) Spezifität (%)<br />
Die histologische Diagnostik ist als<br />
noch sensitiver und spezifischer einzuschätzen<br />
und hat den großen Vorteil,<br />
zusätzlich auch Informationen über den<br />
Zustand der Magenschleimhaut zu liefern.<br />
Die Bakterien lassen sich praktisch<br />
immer mit konventionellen histologischen<br />
Färbungen nachweisen. Immunhistochemische<br />
Verfahren oder In-situ-<br />
Hybridisierung – mit letztgenannter<br />
Methode lassen sich auch Resistenzgene<br />
nachweisen – sind zwar gut evaluiert, in<br />
der klinischen Routine jedoch nur wenig<br />
im Einsatz.<br />
Invasiv Kultur 70–90 100<br />
Histologie 80–98 90–98<br />
Urease-Schnelltest 90–95 90–95<br />
PCR 90–95 90–95<br />
Nicht invasiv Harnstoff-Atemtest 85–95 85–95<br />
Stuhlantigentest 85–95 85–95<br />
IgG-Antikörper im Serum 70–90 70–90<br />
Quelle: zitiert nach Fischbach W et al: S3-Leitlinie „<strong>Helicobacter</strong> <strong>pylori</strong> und gastroduodenale<br />
Ulkuskrankheit“. Z Gastroenterol 2009; 47: 68-102<br />
Tab. 1: Methoden für den Nachweis einer <strong>Helicobacter</strong> <strong>pylori</strong>-Infektion<br />
3/13 Infektiologie & Gastroenterologie-Hepatologie Seite 37 I jatros