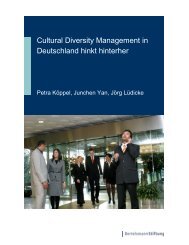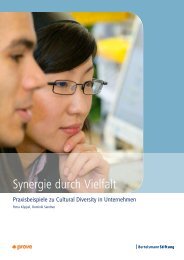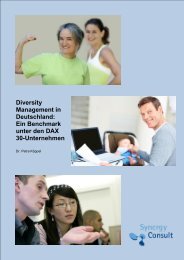BertelsmannStiftung - Synergy Consult
BertelsmannStiftung - Synergy Consult
BertelsmannStiftung - Synergy Consult
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
hohen Beschaffungskosten für Rohöl, Überkapazitäten<br />
in den eigenen Raffinerien und einem<br />
stagnierenden Marktumfeld. Die Veba entschloss<br />
sich, ihre wertvollen Anteile an der Ruhrgas an<br />
die BP zu verkaufen im Gegenzug für die vertragliche<br />
Zusicherung langfristiger Rohöllieferungen<br />
durch die BP und die Abgabe von Raffinerieanteilen<br />
an die BP, um so ihre eigenen<br />
Überkapazitäten abzubauen. Die BP betrachtete<br />
ihr Engagement bei der Ruhrgas als passive<br />
Finanzbeteiligung, die zu einem geeigneten<br />
Zeitpunkt auch veräußert werden könnte. Die BP<br />
in Deutschland hatte somit Aktivitäten in der<br />
Erdölverarbeitung und der Petrochemie, dem<br />
Mineralölvertrieb, dem Schmierstoffgeschäft<br />
sowie – indirekt über die Anteile an der Ruhrgas –<br />
im Gasgeschäft.<br />
Die E.ON AG aus Düsseldorf war der Verhand-<br />
lungspartner der BP. Sie entstand erst am 16. Juni<br />
2000 durch die Fusion der beiden deutschen<br />
Mischkonzerne Veba AG, Düsseldorf, und Viag<br />
AG, München. Beide Organisationen hatten eine<br />
lange Vergangenheit als Konzerne, die vom Staat<br />
gegründet wurden und die erst in den 80er-Jahren<br />
nach und nach privatisiert wurden. So gründete<br />
das preußische Reich 1929 die Vereinigte Elektrizitäts-<br />
und Bergwerks-Aktiengesellschaft<br />
(Veba AG) als Holding, in die der preußische Staat<br />
die Preußische Elektrizitäts Aktiengesellschaft<br />
(PreussenElektra), die Preußische Bergwerksund<br />
Hütten-Aktiengesellschaft (Preussag) sowie<br />
seine anderen Bergwerksaktivitäten beispielsweise<br />
im Ruhrgebiet einbrachte. Mit der<br />
PreussenElektra als „Stromtochter“ hatte Veba<br />
eine gesicherte Wettbewerbsposition, da es auf<br />
der Stufe der regionalen Verbundunternehmen<br />
(RWE, PreussenElektra, Bayernwerk, EnBW, VEW,<br />
HEW, BEWAG, VEAG) Gebietsmonopole gab, die<br />
zuverlässig für hohe Renditen sorgten. Der<br />
einzige Nachteil dieser Struktur war, dass diese<br />
eine weitere Expansion aller Stromkonzerne<br />
innerhalb Deutschlands verhinderte. So wuchs<br />
Veba (ebenso wie die Konkurrenten Viag und<br />
RWE) wegen dieser Restriktionen im Strombereich<br />
durch Firmenzukäufe immer mehr in<br />
Bereiche hinein, die nichts mit Strom oder Kohle<br />
zu tun hatten, und entwickelte sich zu einem<br />
diversifizierten Mischkonzern. Entscheidenden<br />
Einfluss auf die weitere Entwicklung der Stromunternehmen<br />
sollte eine Verordnung der EU<br />
haben: Das europäische Parlament verabschiedete<br />
in 1998 die „Richtlinie für den Elektrizitäts-<br />
Binnenmarkt“, die die schrittweise Öffnung der<br />
bis dahin auf nationaler Ebene voneinander<br />
abgeschotteten Strommärkte innerhalb Europas<br />
vorsah. Es entstand mehr Wettbewerb auf nationaler<br />
wie internationaler Ebene, sodass alle<br />
Stromkonzerne ihre bisherigen Strategien überprüften.<br />
Ebenso wie die Veba aus Düsseldorf<br />
stellte sich die 1923 als Vereinigte Industrie-<br />
Unternehmungen Aktiengesellschaft durch das<br />
Deutsche Reich gegründete Viag Ende der 90er-<br />
Jahre als Mischkonzern mit einer Stromtochter<br />
dar, die in Deutschland stark war, international<br />
gesehen aber auf den mittleren Rängen landete.<br />
Auch die übrigen Konzerntöchter waren in ihren<br />
jeweiligen Branchen eher mittelgroße Spieler.<br />
Vergeblich versuchte die Viag im Jahr 1998 eine<br />
Fusion mit der schweizerischen Alusuisse-Lonza,<br />
die aber an unterschiedlichen Einschätzungen<br />
der Wertrelationen beider Unternehmen<br />
scheiterte.<br />
Als Resultat der geänderten Rahmenbedingungen<br />
vor allem im Strombereich entschlossen sich<br />
beide Unternehmen zum Handeln und schlossen<br />
im September 1999 eine Grundsatzvereinbarung<br />
über den Zusammenschluss beider Unternehmen<br />
in der Form eines merger of equals ab. Als<br />
Kernbereiche des neuen Unternehmens E.ON<br />
AG legte der Vorstand die Geschäftsbereiche<br />
Energie (mit Strom und Öl) und Chemie fest;<br />
alle anderen Aktivitäten sollten entweder über<br />
Verkäufe oder Börsengänge nach und nach aus<br />
dem Konzern ausgegliedert werden. Die E.ON<br />
AG erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2000 einen<br />
Umsatz von rund 93,24 Milliarden Euro und ein<br />
Betriebsergebnis von 2,762 Milliarden Euro mit<br />
rund 186.800 Mitarbeitern. 26<br />
26 E.ON AG (2001) – Geschäftsbericht 2000. Düsseldorf.<br />
Umschlagseite<br />
Die Fallstudie | Die beteiligten Unternehmen<br />
| 21