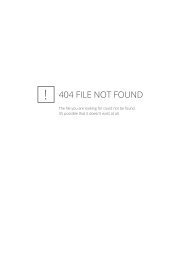Laser-Wakefield-Beschleunigung am JETI-Einfluss der ...
Laser-Wakefield-Beschleunigung am JETI-Einfluss der ...
Laser-Wakefield-Beschleunigung am JETI-Einfluss der ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
4. ExperimenteE t I t a 00, 6 J 2, 3 × 10 18 W/cm 2 1,10, 45 J 1, 7 × 10 18 W/cm 2 0,80, 3 J 1, 1 × 10 18 W/cm 2 0,5Tabelle 4.2.: Nach (3.1) und (2.35) berechnete Werte für die Intensität I t im Fokus und normiertesVektorpotential a 0 für die drei gewählten Pulsenergien E t vor <strong>der</strong> Parabel.Auswertung <strong>der</strong> Zielschirmbil<strong>der</strong> In Abbildung 4.8 sind die gemittelten Zielschirmbil<strong>der</strong>gezeigt. Elektronenbeschleunigung ist mit je<strong>der</strong> <strong>der</strong> drei unterschiedlichen Pulsenergienmöglich. Mit sinken<strong>der</strong> Energie ist aber eine Zunahme <strong>der</strong> Gas- und somit Elektronendichtenötig. Während bei voller Energie schon bei einer Dichte von 9 × 10 18 /cm 3Elektronen auf dem Zielschirm detektiert werden, ist bei einer Pulsenergie von 0, 45 Jeine Elektronendichte von 1, 2 × 10 19 /cm 3 und bei 0, 3 J über 1, 8 × 10 19 /cm 3 nötig.In Abbildung 4.9a ist <strong>der</strong> Anteil <strong>der</strong> Elektronenpakete mit rundem o<strong>der</strong> elliptischemStrahlprofil aufgetragen. Wie im vorherigen Abschnitt wird über das Strahlprofil <strong>am</strong>Zielschirmbild eine Ellipse gelegt, <strong>der</strong>en Mittelpunkt als Strahlrichtung gewählt und <strong>der</strong>enHauptachse zur Berechnung <strong>der</strong> Divergenz des Strahls genutzt wird. Bei zu niedrigerElektronendichte können dabei keine Elektronen <strong>am</strong> Zielschirm beobachtet werdeno<strong>der</strong> die Ladung des detektierten Elektronenpakets ist zu gering, sodass es nicht in dieAuswertung eingeht. Im Bereich mittlerer Elektronendichte zwischen 1, 2 × 10 19 /cm 3und 1, 5 × 10 19 /cm 3 erreicht <strong>der</strong> Anteil an Elektronenpaketen mit gutem Strahlprofilein Maximum. Mit höheren Dichten steigt die Ges<strong>am</strong>thelligkeit <strong>der</strong> Zielschirmbil<strong>der</strong>, dieElektronen sind aber breit gestreut, in <strong>der</strong> Richtung nicht stabil und es treten mehrereMaxima gleichzeitig auf. Die gemittelten Bil<strong>der</strong> zeigen deshalb bei Elektronendichtenvon 1, 8 × 10 19 /cm 3 und 2, 4 × 10 19 /cm 3 trotz höherer Ladung pro Elektronenpaket einebreitere und daher weniger intensive Verteilung. Der Anteil an Elektronenpaketen mitrundem o<strong>der</strong> elliptischem Strahlprofil ist in diesem Bereich wie<strong>der</strong> geringer.Ein charakteristisches Einzelbild für jeden <strong>der</strong> Messpunkte ist in Abbildung 4.10 gezeigt.Während bei geringen Dichten das Strahlprofil annähernd rund bis elliptisch unddie Ladung auf einen kleinen Bereich des Zielschirms konzentriert ist, nimmt <strong>der</strong> Untergrundmit <strong>der</strong> Elektronendichte zu, bis bei einer Dichte von 2, 4 × 10 19 /cm 3 <strong>der</strong> Schirmfast ganz ausgeleuchtet ist und mehrere kleine Maxima zu erkennen sind.Im Diagr<strong>am</strong>m in Abbildung 4.9b ist die Richtungsstabilität <strong>der</strong> einzelnen Messungenaufgetragen. Der ansteigende RMS-Wert zeigt, dass die Elektronenrichtung bei höherenDichten stärker streut. Die höchste Richtungsstabilität wird jeweils <strong>am</strong> zweiten Mess-42