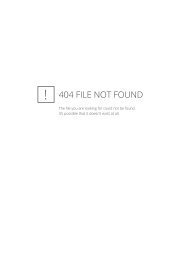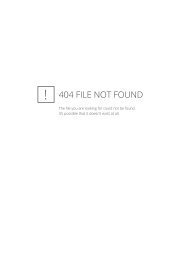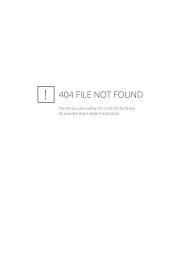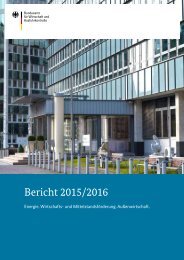Deutscher Bundestag 18/11400 Unterrichtung
NhNlrd
NhNlrd
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Drucksache <strong>18</strong>/<strong>11400</strong><br />
– 52 –<br />
<strong>Deutscher</strong> <strong>Bundestag</strong> – <strong>18</strong>. Wahlperiode<br />
sche Blick auf diese besondere, von der Forschung bislang<br />
weitgehend vernachlässigte Diensteinheit liefert nicht nur<br />
Grundlagen für eine notwendige Quellenkritik im Rahmen<br />
künftiger Forschungen zur Geschichte des MfS. Darüber<br />
hinaus bietet der Sammelband sowohl Anregungen für die<br />
Erforschung der Archivgeschichte der DDR als auch für<br />
eine moderne Institutionengeschichte des MfS.<br />
5.2.6 Hinter vorgehaltener Hand – Studien zur<br />
Denunziationsforschung<br />
Im Januar 2015 wurde der Sammelband „Hinter vorgehaltener<br />
Hand. Studien zur historischen Denunziationsforschung“<br />
als Band 39 der wissenschaftlichen Reihe<br />
„Analysen und Dokumente“ von Anita Krätzner herausgegeben.<br />
Der Band ging aus dem Workshop „Historische<br />
Denunziationsforschung: Methoden, Längsschnitte, Vergleichsperspektiven“<br />
hervor und war erstes Ergebnis des<br />
Projekts „Politische Denunziation in der DDR“ (siehe<br />
Abschnitt 5.3.1). Im Band werden verschiedene Erscheinungsformen<br />
der Denunziation in unterschiedlichen Gesellschaftsformen<br />
und Epochen untersucht. Der Untersuchungszeitraum<br />
erstreckt sich vom Vormärz über den<br />
Nationalsozialismus und legt einen besonderen Fokus auf<br />
die DDR und die Interaktionen von Denunzianten mit der<br />
Staatssicherheit, aber auch mit anderen Institutionen. Die<br />
vergleichende Perspektive des Bandes soll dazu dienen,<br />
den Blick bezüglich der Frage nach gesellschaftlicher Verankerung<br />
der Denunziation und Mitwirkung des Einzelnen<br />
auch im SED-Regime zu schärfen. Zudem geht der Band<br />
quellenkritisch der Frage nach, inwieweit die verschiedenen<br />
Systembedingungen Denunziation förderten und wie<br />
sich Motive der Zuträger ermitteln lassen.<br />
5.2.7 Auftrag: Menschenraub<br />
<br />
DDR-Staatssicherheit in den 50er- und 60er-Jahren etwa<br />
400 Menschen aus West-Berlin und der Bundesrepublik<br />
entführen ließ. Viele kehrten erst nach Monaten oder Jahren<br />
zurück. 24 Entführte wurden hingerichtet, mindestens<br />
zehn weitere starben in der Haft infolge von Krankheit,<br />
Selbsttötung oder Misshandlung. Die Methoden des MfS<br />
<br />
fangreichem<br />
Archivmaterial beleuchtet Susanne Muhle<br />
in ihrer Studie „Auftrag: Menschenraub. Entführungen<br />
von Westberlinern und Bundesbürgern durch das Ministerium<br />
für Staatssicherheit der DDR“ dieses Kapitel der<br />
deutschen Teilung. Dabei widmet sie sich insbesondere<br />
den als Entführern eingesetzten IM. Die Arbeit erschien<br />
2015 in der wissenschaftlichen Reihe des BStU „Analysen<br />
und Dokumente“ als 42. Band. Im gleichen Jahr wurde die<br />
Untersuchung mit dem „Opus Primum“ der Volkswagenstiftung<br />
für die beste wissenschaftliche Nachwuchspublikation<br />
des Jahres ausgezeichnet.<br />
5.2.8 Annäherungen an Robert Havemann<br />
In keinem anderen Intellektuellen der DDR fand das<br />
SED-Regime einen so scharfen Kritiker wie in Robert<br />
Havemann. Der überzeugte Kommunist und NS-Widerstandskämpfer<br />
wirkte nach dem Krieg führend am Aufbau<br />
der DDR mit. Sein Eintreten gegen soziale und politische<br />
Knechtschaft ließ ihn jedoch bald zum Gegner des Regimes<br />
werden und in den Fokus der Staatssicherheit geraten.<br />
Die Beiträge des von Bernd Florath herausgegebenen<br />
Sammelbandes „Annäherungen an Robert Havemann.<br />
Biographische Studien und Dokumente“ beleuchten Wen-<br />
<br />
ihnen zugrunde liegenden geistigen Voraussetzungen. Sie<br />
arbeiten seine Bedeutung für die historische Entwicklung<br />
in der DDR heraus. Die Aufsätze werden ergänzt durch<br />
<br />
Nachlass, Dokumente über die Überwachung des Dissidenten<br />
durch das MfS sowie durch die Fortführung der<br />
<br />
in der Reihe „Analysen und Dokumente“ als Band 43.<br />
5.2.9 In Haft bei der Staatssicherheit –<br />
das Untersuchungsgefängnis<br />
Berlin-Hohenschönhausen<br />
Im Ost-Berliner Stadtbezirk Hohenschönhausen befand<br />
sich das zentrale Untersuchungsgefängnis des MfS. Die<br />
Geheimpolizei ermittelte an diesem streng geheimen Ort<br />
gegen rund 11 000 politische Gegner und andere Personen,<br />
die für das SED-Regime von außerordentlicher Bedeutung<br />
waren. In Hohenschönhausen konzentrierten sich Verfahren<br />
gegen in Ungnade gefallene Politiker, Dissidenten und<br />
Bürgerrechtler. Daneben wurde hier auch gegen NS-Täter<br />
<br />
Spohr vorgelegte Studie „In Haft bei der Staatssicherheit.<br />
Das Untersuchungsgefängnis Berlin-Hohenschönhausen<br />
1951–1989“ stellt exemplarische Häftlingsschicksale vor<br />
und untersucht Haftbedingungen und Vernehmungsmethoden.<br />
Es wird deutlich, dass sich die Alltagssituation der<br />
Insassen und die Praktiken der MfS-Vernehmer im Laufe<br />
der Jahrzehnte erheblich veränderten. Konstant blieben<br />
dagegen die völlige Isolierung der Gefangenen und die<br />
extreme Abschottung des Geschehens nach außen mit all<br />
<br />
als Band 44 der wissenschaftlichen Reihe „Analysen und<br />
Dokumente“ erschienen.<br />
5.2.10 Die Macht der Kirchen brechen –<br />
Mitwirkung des MfS bei der Durchsetzung<br />
der Jugendweihe<br />
Die 2016 in der Reihe „Analysen und Dokumente“ als<br />
Band 45 erschienene Studie „Die Macht der Kirchen brechen.<br />
Die Mitwirkung der Staatssicherheit bei der Durchsetzung<br />
der Jugendweihe in der DDR“ von Markus Anhalt<br />
untersucht anhand der überlieferten Archive des Staatssicherheitsdienstes,<br />
welcher Anteil der Stasi bei der Einführung<br />
der Jugendweihe zukam. Sie zeichnet die Anfänge<br />
der Jugendweihe in der DDR bis zum Ende der 50er-Jahre<br />
nach und klärt über die Mitwirkung der Staatssicherheit<br />
bei der Durchsetzung kirchenpolitischer Ziele auf. Mit<br />
<br />
versuchte, einen Keil zwischen die Gläubigen und ihre<br />
Seelsorger zu treiben. Ende der 50er-Jahre war das Ziel