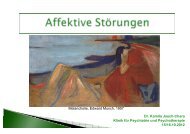Abschlussbericht - UKSH Universitätsklinikum Schleswig-Holstein
Abschlussbericht - UKSH Universitätsklinikum Schleswig-Holstein
Abschlussbericht - UKSH Universitätsklinikum Schleswig-Holstein
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Raucherquote unter den MC-Patienten in etwa derjenigen in der Gesamtbevölkerung: 28,8%<br />
der 215 befragten MC-Patienten gaben in der Studie an aktuell zu rauchen. Dies ist ein<br />
bemerkenswerter (und alarmierender) Befund. Neben dem erhöhten Rezidivrisiko durch<br />
Tabakkonsum führt Rauchen bei MC zu einem schwereren Krankheitsverlauf, erhöht das<br />
Risiko von extraintestinalen Komplikationen, von Osteoporose und ist mit einer<br />
herabgesetzten Lebensqualität assoziiert [34]. Rauchverzicht hingegen beeinflusst den<br />
Krankheitsverlauf der MC-Betroffenen positiv. Daher empfiehlt die S3-Leitlinie „Diagnostik<br />
und Therapie des Morbus Crohn“ den Rauchverzicht bei Morbus Crohn (A): „Patienten, die<br />
rauchen, müssen zu Abstinenz von Tabakgebrauch angehalten werden“[3]. Der Vergleich<br />
von rauchenden und nichtrauchenden MC-Betroffenen der beiden Befragungen zeigt<br />
übereinstimmend, dass unter den Rauchern jeweils signifikant mehr Personen mit<br />
niedrigerer Schulbildung sind. Auch dies entspricht den Befunden in der<br />
Gesamtbevölkerung: Bei Frauen und Männern aus der niedrigen im Vergleich zu denen aus<br />
der hohen Bildungsgruppe ist das Risiko zu rauchen um das 2,3- bzw. 1,9-fache erhöht [36].<br />
Im Weiteren werden unsere Daten zur Ausgangslagenmessung mit den Befunden des<br />
Surveys aus dem Jahr 2005 [1] sowie aus zwei weiteren deutschen CED-Stichproben ([22],<br />
[26]) verglichen.<br />
Dabei finden wir im Großen und Ganzen ein erstaunlich einheitliches Belastungsprofil der<br />
CED-Betroffenen.<br />
Problemlast im Vergleich zum Survey 2005<br />
Im Mittel berichten die Befragten in unserer Studie ebenso wie im Survey 2005 von 3,4<br />
Problemfeldern (Machbarkeitsstudie: MW 3,4, SD 3,5 von 22PF; Survey 2005: MW 3,4, SD<br />
3,3 von 21 PF). Die Häufigkeit aktiver Problemfelder ist in beiden Studien nahezu<br />
vergleichbar. Ähnlich ist die Anzahl derer, die kein aktives Problemfeld aufweisen<br />
(Machbarkeitsstudie: Gesamt 20,2%; Survey 2005: 17,3%).<br />
In Tabelle 17 sind die Häufigkeiten aktiver Problemfelder beider Studien abgebildet.<br />
Aufgrund der unterschiedlichen Zusammensetzung der Stichproben (in 2005 58% MC, in<br />
CED-impl 50%) wurde eine getrennte Darstellung der Ergebnisse nach den Diagnosen MC<br />
und CU vorgenommen. Dargestellt sind nur die Problemfelder, die in gleicher Weise<br />
(Itemformulierung, Antwortkategorien, Problemfeld-Operationalisierung) erhoben wurden.<br />
Wie der Tabelle 17 zu entnehmen ist, schildern sich die Befragten im Survey 2005 nur<br />
hinsichtlich der Problemfelder „Angst“ und „Einschränkung von Alltagsaktivitäten“ als deutlich<br />
stärker belastet als die Teilnehmer der Machbarkeitsstudie.<br />
52



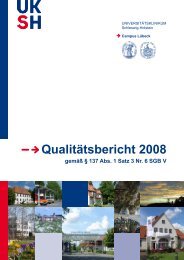



![Ausgabe Januar 2013 [pdf] - UKSH Universitätsklinikum Schleswig ...](https://img.yumpu.com/11131115/1/184x260/ausgabe-januar-2013-pdf-uksh-universitatsklinikum-schleswig-.jpg?quality=85)
![Qualitätsbericht 2011 Campus Kiel [PDF] - UKSH ...](https://img.yumpu.com/9884717/1/184x260/qualitatsbericht-2011-campus-kiel-pdf-uksh-.jpg?quality=85)
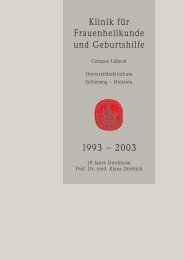

![Interdisziplinäres Symposium Inkontinenz am 24.9.08 [pdf] - UKSH ...](https://img.yumpu.com/7718861/1/190x135/interdisziplinares-symposium-inkontinenz-am-24908-pdf-uksh-.jpg?quality=85)