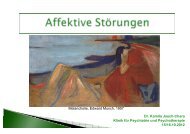Abschlussbericht - UKSH Universitätsklinikum Schleswig-Holstein
Abschlussbericht - UKSH Universitätsklinikum Schleswig-Holstein
Abschlussbericht - UKSH Universitätsklinikum Schleswig-Holstein
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Manifestationen, die gefährdete Teilhabe am Arbeitsleben (bei Erwerbstätigen) und Rauchen<br />
(bei MC-Erkrankten). Etwa jeder 6. Befragte (IG 18%, VG 14%) zeigte eine solche<br />
Problemvielfalt, dass 5 und mehr unterschiedliche Behandlungs-/Beratungszugänge<br />
zurückzumelden waren. Zu beiden Messzeitpunkten zeigen etwa ein Fünftel der<br />
Teilnehmenden kein aktives Problemfeld. Zur ersten Befragung waren 57% der Befragten in<br />
Remission (GIBDI-Score zwischen 0-3), für 13% ergab sich eine mittlere bis schwere<br />
Krankheitsaktivität (GIBDI-Score >7).<br />
53% der Teilnehmer in der Modellregion bewerten das Vorgehen (Bestimmung von<br />
Problembereichen mittels Fragebogen und Rückmeldung dieser mit persönlichen<br />
Handlungsempfehlungen) als gut, 29% als sehr gut.<br />
Die Zufriedenheit mit der Versorgung stieg unter den Teilnehmenden der Modellregion von<br />
der ersten zur zweiten Befragung an. Die Teilnehmer der IG mit erhöhten Angst- oder<br />
Stresswerten zur Erstbefragung ließen im Vergleich zur VG eine vorteilhaftere Entwicklung<br />
erkennen. Unter den Studienteilnehmenden, die mindestens ein aktives Problemfeld<br />
aufwiesen, konnten die IG-Mitglieder eine leichte Verbesserung der sozialen Teilhabe<br />
(gemessen mit dem IMET) erreichen. Der Wunsch nach krankheitsspezifischen<br />
Informationen reduzierte sich in der IG im Vergleich zur VG in überzufälliger Weise.<br />
Während die IG-Mitglieder einerseits zur zweiten Befragung im Vergleich zur ersten von<br />
häufigeren Besuchen in CED-Ambulanzen/Schwerpunktpraxen berichteten, reduzierte sich<br />
andererseits die Anzahl der von ihnen besuchten Arztpraxen. Eine Verschiebung von der<br />
hausärztlichen Betreuung hin zur (hoch)spezialisierten Behandlungsebene ist zu<br />
beobachten. Auswirkungen auf die Nutzung von Beratungs- und Behandlungsangeboten<br />
zeigten sich ebenso wenig wie Veränderungen in der Medikamenteneinnahme. Im Prä-Post-<br />
Vergleich sowie im Vergleich der Gruppen zeigen sich hinsichtlich der Krankheitsaktivität<br />
keine signifikanten Unterschiede.<br />
Diskussion/Ausblick:<br />
Die Bereitschaft der ärztlichen wie nichtärztlichen Behandler zu einer aktiven Teilnahme an<br />
einem Versorgungsnetzwerk CED scheint eher gering zu sein. Umso erfreulicher ist das<br />
erkennbare Interesse der Betroffenen an einer individuell zugeschnittenen Rückmeldung des<br />
eigenen Problemprofils zusammen mit Behandlungs/Beratungsempfehlungen. Für einen<br />
erweiterten Einsatz des fragebogengestützten Screenings von Problemfeldern empfiehlt sich<br />
eine weitere Automatisierung der Auswertung (z.B. internetbasierte Lösung).<br />
Die Machbarkeitsstudie bestätigt die Multifokalität des Krankheitsbildes. Die Patienten und<br />
Patientinnen mit MC oder CU sind im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung deutlich in ihrem<br />
Gesundheitszustand beeinträchtigt. Wir fanden erste Hinweise auf positive Effekte der<br />
komplexen Intervention im Rahmen des Netzwerkaufbaus. Inwieweit die im Projekt<br />
realisierte Form von individualisierter Patienteninformation (Problemprofil plus<br />
Versorgungsempfehlungen) messbare Vorteile für die CED-Patientinnen und Patienten mit<br />
sich bringt, wird aktuell in einer deutschlandweiten randomisierten, kontrollierten<br />
Interventionsstudie im Parallelgruppendesign konfirmatorisch geprüft.<br />
7



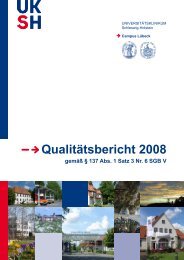



![Ausgabe Januar 2013 [pdf] - UKSH Universitätsklinikum Schleswig ...](https://img.yumpu.com/11131115/1/184x260/ausgabe-januar-2013-pdf-uksh-universitatsklinikum-schleswig-.jpg?quality=85)
![Qualitätsbericht 2011 Campus Kiel [PDF] - UKSH ...](https://img.yumpu.com/9884717/1/184x260/qualitatsbericht-2011-campus-kiel-pdf-uksh-.jpg?quality=85)
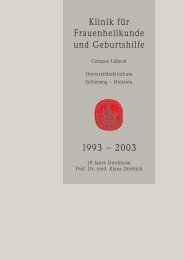

![Interdisziplinäres Symposium Inkontinenz am 24.9.08 [pdf] - UKSH ...](https://img.yumpu.com/7718861/1/190x135/interdisziplinares-symposium-inkontinenz-am-24908-pdf-uksh-.jpg?quality=85)