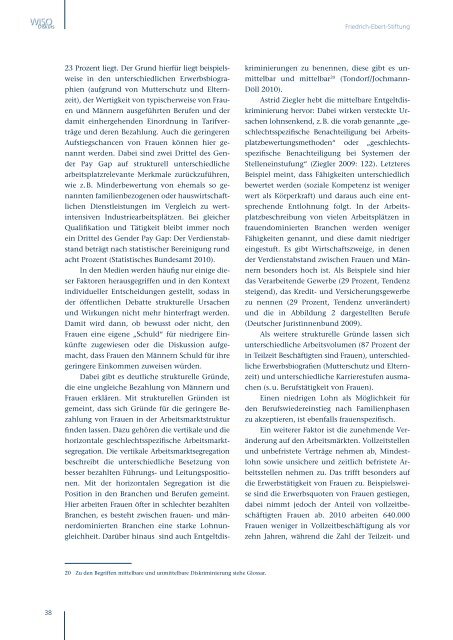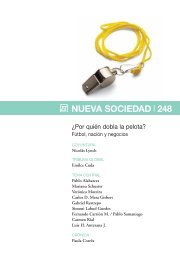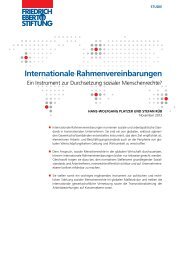Gleichstellungspolitik kontrovers - eine Argumentationshilfe
Gleichstellungspolitik kontrovers - eine Argumentationshilfe
Gleichstellungspolitik kontrovers - eine Argumentationshilfe
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
WISO<br />
Diskurs<br />
38<br />
23 Prozent liegt. Der Grund hierfür liegt beispielsweise<br />
in den unterschiedlichen Erwerbsbiographien<br />
(aufgrund von Mutterschutz und Elternzeit),<br />
der Wertigkeit von typischerweise von Frauen<br />
und Männern ausgeführten Berufen und der<br />
damit einhergehenden Einordnung in Tarifverträge<br />
und deren Bezahlung. Auch die geringeren<br />
Aufstiegschancen von Frauen können hier genannt<br />
werden. Dabei sind zwei Drittel des Gender<br />
Pay Gap auf strukturell unterschiedliche<br />
arbeitsplatzrelevante Merkmale zurückzuführen,<br />
wie z. B. Minderbewertung von ehemals so genannten<br />
familienbezogenen oder hauswirtschaftlichen<br />
Dienstleistungen im Vergleich zu wertintensiven<br />
Industriearbeitsplätzen. Bei gleicher<br />
Qualifi kation und Tätigkeit bleibt immer noch<br />
ein Drittel des Gender Pay Gap: Der Verdienstabstand<br />
beträgt nach statistischer Bereinigung rund<br />
acht Prozent (Statistisches Bundesamt 2010).<br />
In den Medien werden häufi g nur einige dieser<br />
Faktoren herausgegriffen und in den Kontext<br />
individueller Entscheidungen gestellt, sodass in<br />
der öffentlichen Debatte strukturelle Ursachen<br />
und Wirkungen nicht mehr hinterfragt werden.<br />
Damit wird dann, ob bewusst oder nicht, den<br />
Frauen <strong>eine</strong> eigene „Schuld“ für niedrigere Einkünfte<br />
zugewiesen oder die Diskussion aufgemacht,<br />
dass Frauen den Männern Schuld für ihre<br />
geringere Einkommen zuweisen würden.<br />
Dabei gibt es deutliche strukturelle Gründe,<br />
die <strong>eine</strong> ungleiche Bezahlung von Männern und<br />
Frauen erklären. Mit strukturellen Gründen ist<br />
gemeint, dass sich Gründe für die geringere Bezahlung<br />
von Frauen in der Arbeitsmarktstruktur<br />
fi nden lassen. Dazu gehören die vertikale und die<br />
horizontale geschlechtsspezifi sche Arbeitsmarktsegregation.<br />
Die vertikale Arbeitsmarktsegregation<br />
beschreibt die unterschiedliche Besetzung von<br />
besser bezahlten Führungs- und Leitungspositionen.<br />
Mit der horizontalen Segregation ist die<br />
Posi tion in den Branchen und Berufen gemeint.<br />
Hier arbeiten Frauen öfter in schlechter bezahlten<br />
Branchen, es besteht zwischen frauen- und männerdominierten<br />
Branchen <strong>eine</strong> starke Lohnungleichheit.<br />
Darüber hinaus sind auch Entgeltdis-<br />
20 Zu den Begriffen mittelbare und unmittelbare Diskriminierung siehe Glossar.<br />
Friedrich-Ebert-Stiftung<br />
kriminierungen zu benennen, diese gibt es unmittelbar<br />
und mittelbar20 (Tondorf/Jochmann-<br />
Döll 2010).<br />
Astrid Ziegler hebt die mittelbare Entgeltdiskriminierung<br />
hervor: Dabei wirken versteckte Ursachen<br />
lohnsenkend, z. B. die vorab genannte „geschlechtsspezifi<br />
sche Benachteiligung bei Arbeitsplatzbewertungsmethoden“<br />
oder „geschlechtsspezifi<br />
sche Benachteiligung bei Systemen der<br />
Stelleneinstufung“ (Ziegler 2009: 122). Letzteres<br />
Beispiel meint, dass Fähigkeiten unterschiedlich<br />
bewertet werden (soziale Kompetenz ist weniger<br />
wert als Körperkraft) und daraus auch <strong>eine</strong> entsprechende<br />
Entlohnung folgt. In der Arbeitsplatzbeschreibung<br />
von vielen Arbeitsplätzen in<br />
frauendominierten Branchen werden weniger<br />
Fähigkeiten genannt, und diese damit niedriger<br />
eingestuft. Es gibt Wirtschaftszweige, in denen<br />
der Verdienstabstand zwischen Frauen und Männern<br />
besonders hoch ist. Als Beispiele sind hier<br />
das Verarbeitende Gewerbe (29 Prozent, Tendenz<br />
steigend), das Kredit- und Versicherungsgewerbe<br />
zu nennen (29 Prozent, Tendenz unverändert)<br />
und die in Abbildung 2 dargestellten Berufe<br />
(Deutscher Juristinnenbund 2009).<br />
Als weitere strukturelle Gründe lassen sich<br />
unterschiedliche Arbeitsvolumen (87 Prozent der<br />
in Teilzeit Beschäftigten sind Frauen), unterschiedliche<br />
Erwerbsbiografi en (Mutterschutz und Elternzeit)<br />
und unterschiedliche Karrierestufen ausmachen<br />
(s. u. Berufstätigkeit von Frauen).<br />
Einen niedrigen Lohn als Möglichkeit für<br />
den Berufswiedereinstieg nach Familienphasen<br />
zu akzeptieren, ist ebenfalls frauenspezifi sch.<br />
Ein weiterer Faktor ist die zunehmende Veränderung<br />
auf den Arbeitsmärkten. Vollzeitstellen<br />
und unbefristete Verträge nehmen ab, Mindestlohn<br />
sowie unsichere und zeitlich befristete Arbeitsstellen<br />
nehmen zu. Das trifft besonders auf<br />
die Erwerbstätigkeit von Frauen zu. Beispielsweise<br />
sind die Erwerbsquoten von Frauen gestiegen,<br />
dabei nimmt jedoch der Anteil von vollzeit beschäftigten<br />
Frauen ab. 2010 arbeiten 640.000<br />
Frauen weniger in Vollzeitbeschäftigung als vor<br />
zehn Jahren, während die Zahl der Teilzeit- und