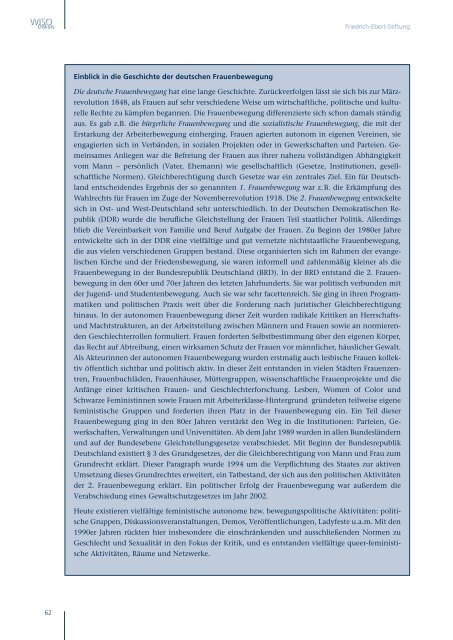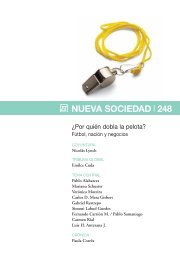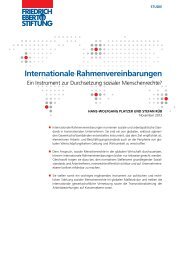Gleichstellungspolitik kontrovers - eine Argumentationshilfe
Gleichstellungspolitik kontrovers - eine Argumentationshilfe
Gleichstellungspolitik kontrovers - eine Argumentationshilfe
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
WISO<br />
Diskurs<br />
62<br />
Einblick in die Geschichte der deutschen Frauenbewegung<br />
Friedrich-Ebert-Stiftung<br />
Die deutsche Frauenbewegung hat <strong>eine</strong> lange Geschichte. Zurückverfolgen lässt sie sich bis zur Märzrevolution<br />
1848, als Frauen auf sehr verschiedene Weise um wirtschaftliche, politische und kulturelle<br />
Rechte zu kämpfen begannen. Die Frauenbewegung differenzierte sich schon damals ständig<br />
aus. Es gab z.B. die bürgerliche Frauenbewegung und die sozialistische Frauenbewegung, die mit der<br />
Erstarkung der Arbeiterbewegung einherging. Frauen agierten autonom in eigenen Ver<strong>eine</strong>n, sie<br />
engagierten sich in Verbänden, in sozialen Projekten oder in Gewerkschaften und Parteien. Gemeinsames<br />
Anliegen war die Befreiung der Frauen aus ihrer nahezu vollständigen Abhängigkeit<br />
vom Mann – persönlich (Vater, Ehemann) wie gesellschaftlich (Gesetze, Institutionen, gesellschaftliche<br />
Normen). Gleichberechtigung durch Gesetze war ein zentrales Ziel. Ein für Deutschland<br />
entscheidendes Ergebnis der so genannten 1. Frauenbewegung war z. B. die Erkämpfung des<br />
Wahlrechts für Frauen im Zuge der Novemberrevolution 1918. Die 2. Frauenbewegung entwickelte<br />
sich in Ost- und West-Deutschland sehr unterschiedlich. In der Deutschen Demokratischen Republik<br />
(DDR) wurde die berufl iche Gleichstellung der Frauen Teil staatlicher Politik. Allerdings<br />
blieb die Vereinbarkeit von Familie und Beruf Aufgabe der Frauen. Zu Beginn der 1980er Jahre<br />
entwickelte sich in der DDR <strong>eine</strong> vielfältige und gut vernetzte nichtstaatliche Frauenbewegung,<br />
die aus vielen verschiedenen Gruppen bestand. Diese organisierten sich im Rahmen der evangelischen<br />
Kirche und der Friedensbewegung, sie waren informell und zahlenmäßig kl<strong>eine</strong>r als die<br />
Frauenbewegung in der Bundesrepublik Deutschland (BRD). In der BRD entstand die 2. Frauenbewegung<br />
in den 60er und 70er Jahren des letzten Jahrhunderts. Sie war politisch verbunden mit<br />
der Jugend- und Studentenbewegung. Auch sie war sehr facettenreich. Sie ging in ihren Programmatiken<br />
und politischen Praxis weit über die Forderung nach juristischer Gleichberechtigung<br />
hinaus. In der autonomen Frauenbewegung dieser Zeit wurden radikale Kritiken an Herrschaftsund<br />
Machtstrukturen, an der Arbeitsteilung zwischen Männern und Frauen sowie an normierenden<br />
Geschlechterrollen formuliert. Frauen forderten Selbstbestimmung über den eigenen Körper,<br />
das Recht auf Abtreibung, <strong>eine</strong>n wirksamen Schutz der Frauen vor männlicher, häuslicher Gewalt.<br />
Als Akteurinnen der autonomen Frauenbewegung wurden erstmalig auch lesbische Frauen kollektiv<br />
öffentlich sichtbar und politisch aktiv. In dieser Zeit entstanden in vielen Städten Frauen zentren,<br />
Frauenbuchläden, Frauenhäuser, Müttergruppen, wissenschaftliche Frauenprojekte und die<br />
Anfänge <strong>eine</strong>r kritischen Frauen- und Geschlechterforschung. Lesben, Women of Color und<br />
Schwarze Feministinnen sowie Frauen mit Arbeiterklasse-Hintergrund gründeten teilweise eigene<br />
feministische Gruppen und forderten ihren Platz in der Frauenbewegung ein. Ein Teil dieser<br />
Frauenbewegung ging in den 80er Jahren verstärkt den Weg in die Institutionen: Parteien, Gewerkschaften,<br />
Verwaltungen und Universitäten. Ab dem Jahr 1989 wurden in allen Bundes ländern<br />
und auf der Bundesebene Gleichstellungsgesetze verabschiedet. Mit Beginn der Bundesrepublik<br />
Deutschland existiert § 3 des Grundgesetzes, der die Gleichberechtigung von Mann und Frau zum<br />
Grundrecht erklärt. Dieser Paragraph wurde 1994 um die Verpfl ichtung des Staates zur aktiven<br />
Umsetzung dieses Grundrechtes erweitert, ein Tatbestand, der sich aus den politischen Aktivitäten<br />
der 2. Frauenbewegung erklärt. Ein politischer Erfolg der Frauenbewegung war au ßerdem die<br />
Verabschiedung <strong>eine</strong>s Gewaltschutzgesetzes im Jahr 2002.<br />
Heute existieren vielfältige feministische autonome bzw. bewegungspolitische Aktivitäten: politische<br />
Gruppen, Diskussionsveranstaltungen, Demos, Veröffentlichungen, Ladyfeste u.a.m. Mit den<br />
1990er Jahren rückten hier insbesondere die einschränkenden und ausschließenden Normen zu<br />
Geschlecht und Sexualität in den Fokus der Kritik, und es entstanden vielfältige queer-feministische<br />
Aktivitäten, Räume und Netzwerke.