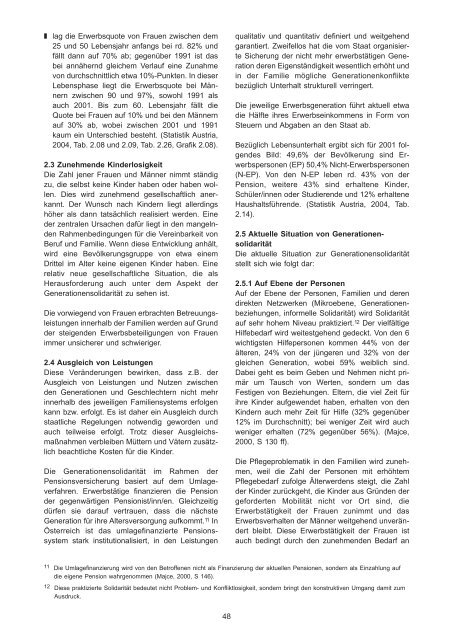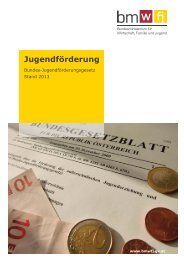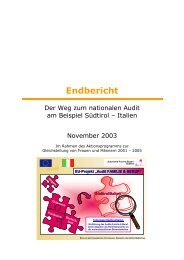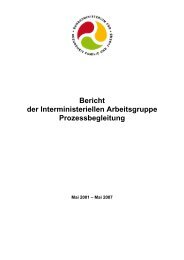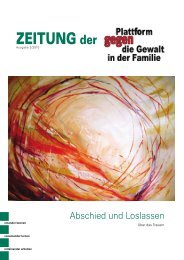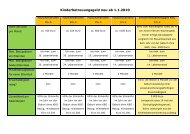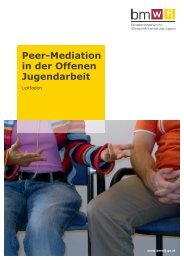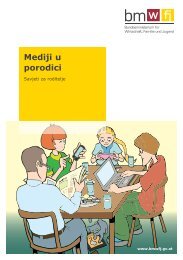Internationales Jahr der Familie - Arbeitskreise - BMWA
Internationales Jahr der Familie - Arbeitskreise - BMWA
Internationales Jahr der Familie - Arbeitskreise - BMWA
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
❚ lag die Erwerbsquote von Frauen zwischen dem<br />
25 und 50 Lebensjahr anfangs bei rd. 82% und<br />
fällt dann auf 70% ab; gegenüber 1991 ist das<br />
bei annähernd gleichem Verlauf eine Zunahme<br />
von durchschnittlich etwa 10%-Punkten. In dieser<br />
Lebensphase liegt die Erwerbsquote bei Männern<br />
zwischen 90 und 97%, sowohl 1991 als<br />
auch 2001. Bis zum 60. Lebensjahr fällt die<br />
Quote bei Frauen auf 10% und bei den Männern<br />
auf 30% ab, wobei zwischen 2001 und 1991<br />
kaum ein Unterschied besteht. (Statistik Austria,<br />
2004, Tab. 2.08 und 2.09, Tab. 2.26, Grafik 2.08).<br />
2.3 Zunehmende Kin<strong>der</strong>losigkeit<br />
Die Zahl jener Frauen und Männer nimmt ständig<br />
zu, die selbst keine Kin<strong>der</strong> haben o<strong>der</strong> haben wollen.<br />
Dies wird zunehmend gesellschaftlich anerkannt.<br />
Der Wunsch nach Kin<strong>der</strong>n liegt allerdings<br />
höher als dann tatsächlich realisiert werden. Eine<br />
<strong>der</strong> zentralen Ursachen dafür liegt in den mangelnden<br />
Rahmenbedingungen für die Vereinbarkeit von<br />
Beruf und <strong>Familie</strong>. Wenn diese Entwicklung anhält,<br />
wird eine Bevölkerungsgruppe von etwa einem<br />
Drittel im Alter keine eigenen Kin<strong>der</strong> haben. Eine<br />
relativ neue gesellschaftliche Situation, die als<br />
Herausfor<strong>der</strong>ung auch unter dem Aspekt <strong>der</strong><br />
Generationensolidarität zu sehen ist.<br />
Die vorwiegend von Frauen erbrachten Betreuungsleistungen<br />
innerhalb <strong>der</strong> <strong>Familie</strong>n werden auf Grund<br />
<strong>der</strong> steigenden Erwerbsbeteiligungen von Frauen<br />
immer unsicherer und schwieriger.<br />
2.4 Ausgleich von Leistungen<br />
Diese Verän<strong>der</strong>ungen bewirken, dass z.B. <strong>der</strong><br />
Ausgleich von Leistungen und Nutzen zwischen<br />
den Generationen und Geschlechtern nicht mehr<br />
innerhalb des jeweiligen <strong>Familie</strong>nsystems erfolgen<br />
kann bzw. erfolgt. Es ist daher ein Ausgleich durch<br />
staatliche Regelungen notwendig geworden und<br />
auch teilweise erfolgt. Trotz dieser Ausgleichsmaßnahmen<br />
verbleiben Müttern und Vätern zusätzlich<br />
beachtliche Kosten für die Kin<strong>der</strong>.<br />
Die Generationensolidarität im Rahmen <strong>der</strong><br />
Pensionsversicherung basiert auf dem Umlageverfahren.<br />
Erwerbstätige finanzieren die Pension<br />
<strong>der</strong> gegenwärtigen Pensionist/inn/en. Gleichzeitig<br />
dürfen sie darauf vertrauen, dass die nächste<br />
Generation für ihre Altersversorgung aufkommt. 11 In<br />
Österreich ist das umlagefinanzierte Pensionssystem<br />
stark institutionalisiert, in den Leistungen<br />
48<br />
qualitativ und quantitativ definiert und weitgehend<br />
garantiert. Zweifellos hat die vom Staat organisierte<br />
Sicherung <strong>der</strong> nicht mehr erwerbstätigen Generation<br />
<strong>der</strong>en Eigenständigkeit wesentlich erhöht und<br />
in <strong>der</strong> <strong>Familie</strong> mögliche Generationenkonflikte<br />
bezüglich Unterhalt strukturell verringert.<br />
Die jeweilige Erwerbsgeneration führt aktuell etwa<br />
die Hälfte ihres Erwerbseinkommens in Form von<br />
Steuern und Abgaben an den Staat ab.<br />
Bezüglich Lebensunterhalt ergibt sich für 2001 folgendes<br />
Bild: 49,6% <strong>der</strong> Bevölkerung sind Erwerbspersonen<br />
(EP) 50,4% Nicht-Erwerbspersonen<br />
(N-EP). Von den N-EP leben rd. 43% von <strong>der</strong><br />
Pension, weitere 43% sind erhaltene Kin<strong>der</strong>,<br />
Schüler/innen o<strong>der</strong> Studierende und 12% erhaltene<br />
Haushaltsführende. (Statistik Austria, 2004, Tab.<br />
2.14).<br />
2.5 Aktuelle Situation von Generationensolidarität<br />
Die aktuelle Situation zur Generationensolidarität<br />
stellt sich wie folgt dar:<br />
2.5.1 Auf Ebene <strong>der</strong> Personen<br />
Auf <strong>der</strong> Ebene <strong>der</strong> Personen, <strong>Familie</strong>n und <strong>der</strong>en<br />
direkten Netzwerken (Mikroebene, Generationenbeziehungen,<br />
informelle Solidarität) wird Solidarität<br />
auf sehr hohem Niveau praktiziert. 12 Der vielfältige<br />
Hilfebedarf wird weitestgehend gedeckt. Von den 6<br />
wichtigsten Hilfepersonen kommen 44% von <strong>der</strong><br />
älteren, 24% von <strong>der</strong> jüngeren und 32% von <strong>der</strong><br />
gleichen Generation, wobei 59% weiblich sind.<br />
Dabei geht es beim Geben und Nehmen nicht primär<br />
um Tausch von Werten, son<strong>der</strong>n um das<br />
Festigen von Beziehungen. Eltern, die viel Zeit für<br />
ihre Kin<strong>der</strong> aufgewendet haben, erhalten von den<br />
Kin<strong>der</strong>n auch mehr Zeit für Hilfe (32% gegenüber<br />
12% im Durchschnitt); bei weniger Zeit wird auch<br />
weniger erhalten (72% gegenüber 56%). (Majce,<br />
2000, S 130 ff).<br />
Die Pflegeproblematik in den <strong>Familie</strong>n wird zunehmen,<br />
weil die Zahl <strong>der</strong> Personen mit erhöhtem<br />
Pflegebedarf zufolge Älterwerdens steigt, die Zahl<br />
<strong>der</strong> Kin<strong>der</strong> zurückgeht, die Kin<strong>der</strong> aus Gründen <strong>der</strong><br />
gefor<strong>der</strong>ten Mobilität nicht vor Ort sind, die<br />
Erwerbstätigkeit <strong>der</strong> Frauen zunimmt und das<br />
Erwerbsverhalten <strong>der</strong> Männer weitgehend unverän<strong>der</strong>t<br />
bleibt. Diese Erwerbstätigkeit <strong>der</strong> Frauen ist<br />
auch bedingt durch den zunehmenden Bedarf an<br />
11 Die Umlagefinanzierung wird von den Betroffenen nicht als Finanzierung <strong>der</strong> aktuellen Pensionen, son<strong>der</strong>n als Einzahlung auf<br />
die eigene Pension wahrgenommen (Majce, 2000, S 146).<br />
12 Diese praktizierte Solidarität bedeutet nicht Problem- und Konfliktlosigkeit, son<strong>der</strong>n bringt den konstruktiven Umgang damit zum<br />
Ausdruck.