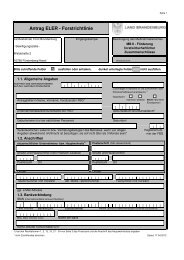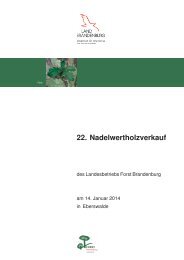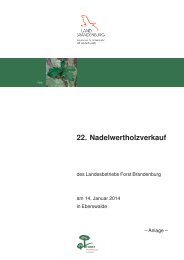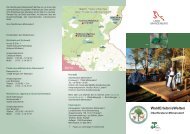Die Schwarz-Erle (Alnus glutinosa [L.] GAERTN.) - Landesbetrieb ...
Die Schwarz-Erle (Alnus glutinosa [L.] GAERTN.) - Landesbetrieb ...
Die Schwarz-Erle (Alnus glutinosa [L.] GAERTN.) - Landesbetrieb ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
tes Ausklopfen dafür Sorge zu tragen, dass die<br />
Zapfen die Samen auch vollständig entlassen. <strong>Die</strong><br />
Samenaufbereitung und Einlagerung erfolgt wie bei<br />
Kiefern- und Fichtensamen (SCHUBERT, 1999).<br />
Das Entflügeln geschieht durch vorsichtiges Abreiben.<br />
<strong>Die</strong> Zapfen können aber auch in einer Darre<br />
bei 55 °C geklengt werden, wobei diese zwecks<br />
vollständiger Entleerung anschließend vorsichtig geschrotet<br />
werden sollten. <strong>Die</strong> Reinigung erfolgt mittels<br />
Steigsichter oder Handsieb. <strong>Die</strong> Saatgut-Ausbeute<br />
ist dabei mindestens um ein Drittel höher<br />
als beim einfachen Ausklopfen (WINKLER, 1955).<br />
Aus 100 kg Zapfen können ca. 5–10 kg <strong>Erle</strong>nsamen<br />
gewonnen werden, wobei 1 kg <strong>Erle</strong>nsamen<br />
etwa 500.000–600.000 Samenkörner enthält. Nach<br />
SCHUBERT (1999) schwankt die Keimqualität<br />
zwischen den einzelnen Ernten erheblich.<br />
<strong>Erle</strong>nsaatgut ist gegenüber Austrocknung unempfindlich,<br />
auch ein vollständiger Wasserentzug<br />
hinterlässt keine Schäden (SCHÖNBORN, 1964).<br />
<strong>Die</strong> längerfristige Lagerung sollte in luftdicht verschlossenen<br />
Gefäßen erfolgen, da die Samen im<br />
Laufe der Zeit Wasser aufnehmen und dann Keimfähigkeitsverluste<br />
eintreten können. Für die Einlagerung<br />
sind Temperaturen um -5°C und ein Wassergehalt<br />
unter 5 % günstig. In den Darren der DDR<br />
wurde <strong>Erle</strong>nsaatgut nicht länger als vier Jahre gelagert.<br />
Dennoch ist bei optimalen Bedingungen von<br />
einer Lagerfähigkeit von über zehn Jahren auszugehen<br />
(SCHUBERT, 1999).<br />
Pflanzenanzucht<br />
<strong>Die</strong> Aussaat im Freiland erfolgt bei entsprechender<br />
Witterung (Februar bis April) nach Möglichkeit<br />
auf dem tauenden Schnee. Das vorbereitete Saatbeet<br />
sollte in einem frischen und schattigen Be-<br />
ZUR BERÜCKSICHTIGUNG DES GENETISCHEN POTENZIALS VON SCHWARZ-ERLE ...<br />
Tab. 6: im Handel erhältliche Sortimente der Baumart <strong>Schwarz</strong>-<strong>Erle</strong><br />
reich liegen. Eine zeitweise Austrocknung kann zum<br />
Ausfall der Saat führen. <strong>Die</strong> Saat wird leicht eingeharkt<br />
und angedrückt. <strong>Die</strong> Ausbeute aus 1 kg<br />
Samen beträgt etwa 60.000 Pflanzen. <strong>Die</strong> Keimung<br />
beginnt nach ca. 3–4 Wochen und erfolgt oberirdisch<br />
(epigäisch). Auf feuchten Böden wird auch<br />
die Methode des Absenkens durchgeführt. Veredlungen<br />
haben nur unter Glas Erfolg und werden<br />
aufgrund des Aufwandes aber kaum durchgeführt<br />
(KRÜSSMANN,1981).<br />
Meist werden 2-jährige verschulte Pflanzen mit<br />
einer Größe von 40–60 cm und einer Stückzahl<br />
von 2.500 bis 5.000 Stück je ha durch die Pflanzenanzuchtbetriebe<br />
angeboten.<br />
<strong>Die</strong> Begründung eines <strong>Schwarz</strong>-<strong>Erle</strong>nbestandes<br />
kann auch in Form von Freiflächensaaten erfolgen,<br />
wobei ein Mengenbedarf von 10–20 kg/ha gerechnet<br />
wird.<br />
Grundsätzlich steht ein ausreichendes Angebot<br />
an Vermehrungsgut für die <strong>Schwarz</strong>-<strong>Erle</strong> zur<br />
Verfügung. Mit dem Auftreten des „neuartigen<br />
<strong>Erle</strong>nsterbens“ durch Phytophthora-Infektionen besteht<br />
jedoch die Gefahr, den Erreger auch über<br />
Baumschulpflanzen zu verbreiten. Da die Symptome<br />
an den jungen Pflanzen nicht okular erkannt<br />
werden können, wären aufwendige mikrobiologische<br />
Überprüfungen von Baumschulquartieren notwendig.<br />
Zur Risikominderung besteht daher seit<br />
2001 eine ministerielle Anordnung für ein vorübergehendes<br />
Pflanzverbot für <strong>Schwarz</strong>-<strong>Erle</strong>n (siehe<br />
Beitrag von Dr. PAUL HEYDECK „Gefährdung der<br />
<strong>Schwarz</strong>-<strong>Erle</strong> durch mikrobielle Pathogene“). Bleibt<br />
zu hoffen, dass infolge einer zu intensivierenden<br />
Forschung in naher Zukunft die biologischen Grundlagen<br />
und Rahmenbedingungen der Infektionen erkannt,<br />
kostengünstige Erregernachweise entwikkelt<br />
und möglicherweise auch resistente <strong>Schwarz</strong>-<br />
<strong>Erle</strong>n gefunden werden.<br />
107


![Die Schwarz-Erle (Alnus glutinosa [L.] GAERTN.) - Landesbetrieb ...](https://img.yumpu.com/2018570/108/500x640/die-schwarz-erle-alnus-glutinosa-l-gaertn-landesbetrieb-.jpg)