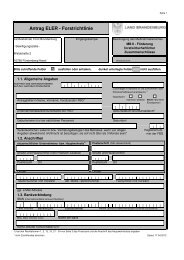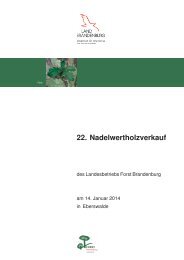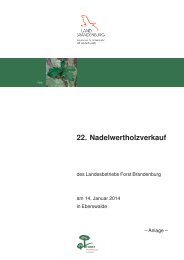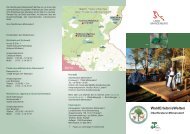Die Schwarz-Erle (Alnus glutinosa [L.] GAERTN.) - Landesbetrieb ...
Die Schwarz-Erle (Alnus glutinosa [L.] GAERTN.) - Landesbetrieb ...
Die Schwarz-Erle (Alnus glutinosa [L.] GAERTN.) - Landesbetrieb ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Fomitopsis pinicola (SWARTZ: FR.) P.<br />
KARST., Rotrandiger Baumschwamm<br />
F. pinicola lebt überwiegend saprophytisch an<br />
abgestorbenen Stämmen sowie an Stubben. Gelegentlich<br />
kann der Pilz auch als Wund- bzw. Schwächeparasit<br />
auf vorgeschädigten Bäumen in Erscheinung<br />
treten (JAHN, 1990; SCHWARZE et al., 1999).<br />
Der Rotrandige Baumschwamm besiedelt Nadelund<br />
Laubgehölze, im Gebirge überwiegend Picea<br />
(„Fichtenporling“), sonst Fagus, Betula, <strong>Alnus</strong>,<br />
Pinus, Abies u. a.<br />
F. pinicola verursacht Braunfäule; das besiedelte<br />
Holz wird brüchig, bekommt Risse und zerfällt würfelförmig.<br />
<strong>Die</strong> Oberseite der konsolenförmigen,<br />
mehrjährigen Fruchtkörper ist mit einer harzartigen<br />
Kruste bedeckt. Der Rand weist eine orangegelbe<br />
bis rote Färbung auf.<br />
Ganoderma lipsiense (BATSCH) ATK., Flacher<br />
Lackporling<br />
G. lipsiense ist ein häufig vorkommender Saprophyt.<br />
Man findet den Pilz meist an Laubholz (besonders<br />
Fagus, ferner <strong>Alnus</strong>, Betula, Fraxinus,<br />
Quercus, Populus, Tilia u. a.). Nadelholz besiedelt<br />
der Weißfäuleerreger hingegen nur sehr selten. Auf<br />
vorgeschädigten Bäumen lebt er gelegentlich als<br />
Schwächeparasit (vgl. KREISEL, 1961; SCHWAR-<br />
ZE et al., 1999). <strong>Die</strong> flach-konsolenförmigen, mehrjährigen<br />
Fruchtkörper sind oberseits grau- bis rostbraun<br />
gefärbt, Zuwachsrand und Poren hingegen<br />
weiß.<br />
Ganoderma lucidum (CURTIS: FR.) P.<br />
KARST., Glänzender Lackporling<br />
G. lucidum kommt als Schwächeparasit im<br />
Wurzel- bzw. Stammbasisbereich verschiedener<br />
Laubbäume vor (vgl. KREISEL, 1961). Man findet<br />
den Weißfäuleerreger auch saprophytisch an abgestorbenen<br />
Stämmen und Stubben. Der Glänzende<br />
Lackporling besiedelt <strong>Alnus</strong>, Betula, Fagus,<br />
Quercus, Carpinus u. a. Laubgehölze, selten auch<br />
Koniferen (doch nicht Abies). In <strong>Erle</strong>nbruchwäldern<br />
trifft man gelegentlich auf ihn. <strong>Die</strong> halbkreis- bis<br />
fächerförmigen, seitlich gestielten Fruchtkörper bilden<br />
sich meist an der Stammbasis oder über Wurzeln.<br />
Hut und Stiel sind mit einer glänzenden braunroten<br />
Lackschicht bedeckt.<br />
Heterobasidion annosum (FR.) BREF.,<br />
Wurzelschwamm<br />
Der Wurzelschwamm gilt in den Wäldern der<br />
nördlich gemäßigten Klimazone als bedeutendster<br />
pilzlicher Schaderreger (vgl. SCHMIDT, 1994;<br />
BUTIN, 1996; WOODWARD et al., 1998). Er<br />
kommt als wurzelbürtiger Schwächeparasit auf<br />
zahlreichen Nadelbäumen vor, ferner auch an Laub-<br />
GEFÄHRDUNG DER SCHWARZ-ERLE ... DURCH MIKROBIELLE PATHOGENE<br />
gehölzen (breites Wirtsspektrum). Nach SCHWAR-<br />
ZE et al. (1999) kennt man ca. 200 verschiedene<br />
Wirte. Forstwirtschaftlich fühlbare Schäden verursacht<br />
der genannte Pilz besonders an Fichte („Rotfäule“)<br />
und Kiefer („Ackersterbe“). <strong>Die</strong> Schadwirkung<br />
an Laubbäumen ist deutlich geringer. Der Chemismus<br />
des Holzabbaus entspricht einer Weißfäule.<br />
Auch im nordostdeutschen Tiefland verursacht<br />
der Wurzelschwamm gravierende Schäden (HEYD-<br />
ECK, 2000). SCHUMACHER et al. (2001) isolierten<br />
H. annosum aus dem Holz einer lebenden<br />
<strong>Schwarz</strong>-<strong>Erle</strong>. <strong>Die</strong> konsolen- oder krustenförmigen,<br />
mehrjährigen Fruchtkörper zeigen oberseits braune<br />
Farbtöne. Zuwachskante und Poren sind hingegen<br />
weißlich gefärbt.<br />
Inonotus obliquus (PERS.: FR.) PIL., Schiefer<br />
Schillerporling<br />
I. obliquus lebt überwiegend parasitisch, meist<br />
an Betula, seltener auf anderen Laubbäumen (darunter<br />
<strong>Alnus</strong> spp.). Der Pilz erregt im besiedelten<br />
Holz Weißfäule und kann befallene Stämme abtöten<br />
(KREISEL, 1961; RYPÁCEK, 1966; JAHN,<br />
1990). Gelegentlich findet man ihn auch auf abgestorbenen<br />
Bäumen. Der Schiefe Schillerporling<br />
zählt zu den häufigsten und bedeutendsten Holzparasiten<br />
an <strong>Schwarz</strong>-<strong>Erle</strong> (vgl. SCHUMACHER et<br />
al., 2001). Meist trifft man nur die imperfekten<br />
Fruchtkörper des Pilzes an (knollenförmige, holzharte,<br />
schwarz gefärbte, rissig-zerklüftete Gebilde).<br />
Inonotus radiatus (SOW.: FR.) P. KARST.,<br />
<strong>Erle</strong>n-Schillerporling<br />
Der <strong>Erle</strong>n-Schillerporling ist ein weit verbreiteter<br />
Wund- und Schwächeparasit an vorgeschädigten<br />
<strong>Erle</strong>n (auch Saprophyt auf totem Holz). Man findet<br />
den Pilz in jedem <strong>Erle</strong>nbruchwald (JAHN, 1990). In<br />
manchen Beständen tritt der Weißfäuleerreger<br />
nahezu epidemisch auf. Oft werden seine Fruchtkörper<br />
an Stämmen, die von der <strong>Erle</strong>n-Phytophthora<br />
infiziert sind, beobachtet. I. radiatus scheint sich<br />
dabei in einem frühen Stadium des Befalls zu etablieren.<br />
Der Pilz zählt zur Gruppe der häufigsten und<br />
bedeutendsten Holzparasiten sowie Fäuleerreger<br />
an <strong>Schwarz</strong>-<strong>Erle</strong> (SCHUMACHER et al., 2001).<br />
Befallene Stämme brechen leicht um. <strong>Die</strong> eng dachziegelig<br />
wachsenden Fruchtkörper sind jung oberseits<br />
lebhaft gelborange, rostgelb oder rostrot gefärbt<br />
(Abb. 4).<br />
Pholiota aurivella (BATSCH: FR.) KUMM.,<br />
Hochthronender Schüppling<br />
Auch der Hochthronende Schüppling gehört zu<br />
den phytopathologisch wichtigsten Holzparasiten<br />
bzw. Fäuleerregern an <strong>Schwarz</strong>-<strong>Erle</strong> (vgl. SCHU-<br />
MACHER et al., 2001). Der Pilz ist ein häufiger<br />
67


![Die Schwarz-Erle (Alnus glutinosa [L.] GAERTN.) - Landesbetrieb ...](https://img.yumpu.com/2018570/68/500x640/die-schwarz-erle-alnus-glutinosa-l-gaertn-landesbetrieb-.jpg)