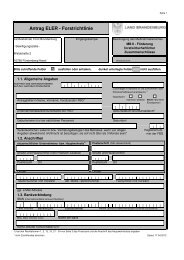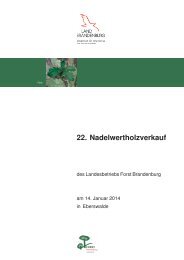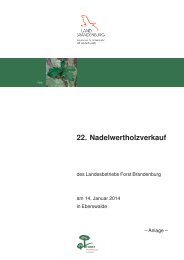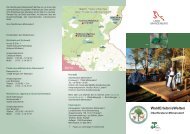Die Schwarz-Erle (Alnus glutinosa [L.] GAERTN.) - Landesbetrieb ...
Die Schwarz-Erle (Alnus glutinosa [L.] GAERTN.) - Landesbetrieb ...
Die Schwarz-Erle (Alnus glutinosa [L.] GAERTN.) - Landesbetrieb ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
42<br />
ZUM PHYSIOLOGISCHEN ANPASSUNGSPOTENZIAL DER SCHWARZ-ERLE ...<br />
fel-Protein, dessen biochemische<br />
energieverbrauchende<br />
(ATP) Funktionsweise gut untersucht<br />
ist (Übersicht z. B.<br />
WEIDE und AURICH, 1979).<br />
Eine besondere Eigenschaft<br />
der Nitrogenase von anaerobisch<br />
lebenden Bakterien ist<br />
ihre Hemmbarkeit durch molekularen<br />
Sauerstoff. Im Knöllchengewebe<br />
müssen daher<br />
besondere Strukturen vorliegen,<br />
die die Nitrogenase vor<br />
hohen Sauerstoff-Parzialdrücken<br />
schützen. <strong>Die</strong>se Aufgabe<br />
erfüllt das Porphyrin-Proteid<br />
Leghämoglobin. Nach aufwändigen<br />
Untersuchungen an<br />
Rhizobien unter Reinkulturbedingungen<br />
im Laboratorium<br />
nimmt man an, dass im Innern<br />
der Bakterienkolonien so sauerstoffarme<br />
Zonen entstehen,<br />
in denen der Sauerstoff-Partialdruck für die Bildung<br />
der Nitrogenase zuträglich ist.<br />
<strong>Die</strong> Stickstofffixierung in den Wurzelknöllchen<br />
der <strong>Erle</strong> ist von vielen äußeren Faktoren abhängig.<br />
So wird die Nitrogenase häufig nur unter Bedingungen<br />
gebildet, unter denen sie benötigt wird, also<br />
in Abwesenheit einer verwertbaren Stickstoffquelle.<br />
Zusätzliche Ammonium-Ionen reprimieren die Synthese<br />
der Nitrogenase. Generell wird die Symbioseleistung<br />
entscheidend von dem N-Gehalt der Bodenlösung<br />
beeinflusst. Hohe Stickstoff-Werte beeinträchtigen<br />
die Bildung von Wurzelhaaren und damit<br />
auch die Voraussetzung zur Entstehung der<br />
Symbiose (Infektion über Wurzelhaare) (DITTERT,<br />
1992; HUSS-DANELL, 1997; KAMMANN und KAP-<br />
PEN, 1996). Dagegen ist die verstärkte Wurzelhaarbildung<br />
unter N-Mangel ein Anpassungsmechanismus<br />
zur Steigerung der Infektion und damit<br />
zur Knöllchenbildung.<br />
Auch wenn die N -Fixierung energetisch aufwän-<br />
2<br />
- diger ist als die einfache Assimilation von NO oder 3<br />
+ gar von NH Ionen, wurden bei Düngungsexperi-<br />
4<br />
menten nahezu gleiche Wachstumsraten bei N - 2<br />
fixierenden und N-versorgten <strong>Erle</strong>n gefunden (ING-<br />
ESTAD, 1981; SELLSTEDT, 1986; SELLSTEDT<br />
und HUSS-DANELL, 1986). Nur in der Anfangsphase<br />
war eine verzögerte Biomasseproduktion bei<br />
den N -fixierenden <strong>Erle</strong>n gegenüber den N-versorg-<br />
2<br />
ten <strong>Erle</strong>n zu beobachten, was die Kosten für die<br />
Knöllchenbildung und -aktivität anzeigt. Letztendlich<br />
war die N-Konzentration in den Geweben der<br />
N-Selbstversorger-<strong>Erle</strong>n höher als die der Kontroll-<br />
Abb. 1: Wurzelzellen werden zur Zellteilung angeregt, so dass unter<br />
Vermittlung von Wuchsstoffen die Knöllchen als Gewebewucherungen<br />
entstehen<br />
<strong>Erle</strong>n. Offenbar kam es zu einer positiven Rückkopplung<br />
zwischen steigender Photosyntheseleistung<br />
(Assimilatlieferung) und verstärktem Knöllchenwachstum<br />
(Stickstofflieferung) im Sinne von<br />
DAWSON und GORDON (1979; vgl. NORBY,<br />
1987).<br />
<strong>Die</strong> N-Konzentration in den Blättern von <strong>Alnus</strong><br />
<strong>glutinosa</strong> wird mit 2,95 % angegeben (LYR et al.,<br />
1992).<br />
<strong>Die</strong> Ergebnisse zeigen, dass sich die <strong>Erle</strong> flexibel<br />
auf das Stickstoffangebot des Bodens einstellen<br />
kann, jedoch am natürlichen Standort auf die<br />
verfügbare Infektion mit Frankia angewiesen ist.<br />
Dass die Wurzelknöllchen der <strong>Erle</strong> das Überleben<br />
auf stickstoffarmen Sanden ermöglichen, war<br />
bereits vor über 100 Jahren bekannt. HILTER (1889)<br />
schrieb: „Besonders anschaulich tritt diese wunderbare<br />
Wirkung der Knöllchen bei den <strong>Erle</strong>n hervor,<br />
wenn man mehrjährige Exemplare, die bis dahin<br />
in stickstoffhaltiger Erde wuchsen, in völlig<br />
stickstofffreien Sand verpflanzt. <strong>Die</strong> mit den<br />
Wurzelknöllchen versehenen Pflanzen gedeihen in<br />
diesem Sande in gleicher weise weiter wie bisher,<br />
ja die Größe und das Grün ihrer Blätter nimmt eher<br />
noch zu; die knöllchenfreien Bäumchen lassen dagegen<br />
nur noch ganz kurze Zeit einen unbedeutenden<br />
Zuwachs erkennen, die wenigen sich noch<br />
entwickelnden Blätter werden immer kleiner und<br />
schon nach wenigen Wochen weisen sie alle Symptome<br />
des Stickstoffhungers auf.“<br />
Umfangreiche Untersuchungen zur Heterogenität<br />
der Knöllchenhäufigkeit unter Freilandbedingun-


![Die Schwarz-Erle (Alnus glutinosa [L.] GAERTN.) - Landesbetrieb ...](https://img.yumpu.com/2018570/43/500x640/die-schwarz-erle-alnus-glutinosa-l-gaertn-landesbetrieb-.jpg)