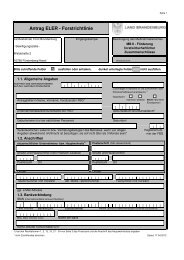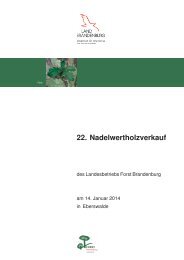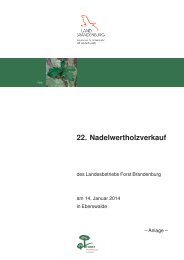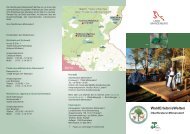Die Schwarz-Erle (Alnus glutinosa [L.] GAERTN.) - Landesbetrieb ...
Die Schwarz-Erle (Alnus glutinosa [L.] GAERTN.) - Landesbetrieb ...
Die Schwarz-Erle (Alnus glutinosa [L.] GAERTN.) - Landesbetrieb ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
114<br />
DIE BEWIRTSCHAFTUNG DER SCHWARZ-ERLE IM SPREEWALD<br />
der Kartierung von 2002 vorrangig die Standorte der<br />
ökologischen Feuchtestufe sehr sumpfig, sumpfig<br />
bis nass. Das Optimum liegt dabei im sumpfigen<br />
und nassen Bereich, während auf sehr sumpfigen<br />
Standorten die forstliche Bewirtschaftung schon<br />
stark eingeschränkt ist. Nach Trophie und Feuchtestufen<br />
konzentrieren sich damit der <strong>Erle</strong>nanbau und<br />
die <strong>Erle</strong>n-Betriebsklasse auf die Reviere Schützenhaus,<br />
Buchenhain, Boblitz und Groß Wasserburg.<br />
Hier liegen die letzten zusammenhängenden<br />
<strong>Schwarz</strong>-<strong>Erle</strong>nbestände Brandenburgs! Ihr Erhalt<br />
hängt entscheidend von den zu erwartenden<br />
Gebietswasserständen ab. Großflächige und andauernde<br />
Überstauungen sind zu vermeiden, da<br />
dies eine drastische Veränderung der Vegetationstypen<br />
und Waldökosysteme in Richtung nicht bewirtschaftungsfähiger<br />
Sumpfgehölze zur Folge hätte.<br />
<strong>Die</strong> Weiterführung des <strong>Schwarz</strong>-<strong>Erle</strong>nanbaues<br />
setzt außerdem die Nutzung aller möglichen Präventivmaßnahmen<br />
gegen den Befall von Phytophthora<br />
voraus, also Rabatten mit flachen Gräben,<br />
Vorflutanschluss und Wasserstandsregulierung<br />
(SCHUMACHER 2002). Jede undifferenzierte Anhebung<br />
oder Senkung des Wasserstandes und<br />
andauernde Überflutung gefährden die <strong>Erle</strong>nwälder,<br />
unabhängig von der angewandten Betriebsform<br />
Hoch- oder Niederwald.<br />
Wissen und Erfahrung aus über zwei Jahrhunderten<br />
<strong>Erle</strong>n-Betriebsklasse im Spreewald sind unter<br />
den sich ändernden wirtschaftlichen und ökologischen<br />
Bedingungen zu nutzen!<br />
Das Entwicklungskonzept für<br />
die <strong>Erle</strong>nwälder nach dem<br />
Pflege- und Entwicklungsplan<br />
für das Biosphärenreservat<br />
Der Pflege- und Entwicklungsplan (PEP) basiert<br />
auf einer 1996/1997 flächendeckend durchgeführten<br />
Biotoptypenkartierung nach dem Brandenburger<br />
Kartierschlüssel mit zusätzlichen Erhebungen<br />
zu Waldstruktur und natürlicher Verjüngungstendenz.<br />
Unter Abgleich der Standortkartierung von<br />
1960 erfolgte für jeden Biotop die Festlegung eines<br />
Ziel- Biotoptyps. An diese langfristige planerische<br />
Aussage wurden kurz- und mittelfristige Maßnahmen<br />
zur Zielerreichung geknüpft.<br />
Der PEP wurde mit der zeitgleich für den<br />
Landeswald durchgeführten Naturalplanung abgestimmt<br />
(Basis: Gemeinsamer Runderlass der damaligen<br />
Ministerien MUNR und MELF vom 25. April<br />
1999). Dabei konnte für die bis 2006 geplanten<br />
Maßnahmen Einvernehmen erzielt werden.<br />
Das Konzept des PEP sieht eine Differenzierung<br />
von Bewirtschaftungsart und -intensität innerhalb<br />
der vorhandenen <strong>Erle</strong>nwälder nach den Kriterien<br />
Vegetationsgesellschaften, Bodeneigenschaften,<br />
Naturnähe und Reife der Waldökosysteme, ihre<br />
Lebensraumfunktion sowie nach wirtschaftlichen<br />
Kriterien vor. In <strong>Erle</strong>nbeständen, die den Vegetationsgesellschaften<br />
Wasserfeder-<strong>Erle</strong>n-Wald, Schilf-<br />
<strong>Erle</strong>n-Wald und teilweise dem Großseggen-<strong>Erle</strong>n-<br />
Wald zuzuordnen sind, Lebensräumen seltener<br />
Großvogelarten sowie sehr alten Wäldern wurde<br />
ein Nutzungsverzicht aus ökologischen Gründen<br />
vorgeschlagen. Im Bereich der <strong>Erle</strong>nwälder der<br />
Ausprägung des Rasenschmielen-<strong>Erle</strong>nwaldes,<br />
des krautreichen <strong>Erle</strong>nwaldes und Brennessel-<br />
<strong>Erle</strong>nwaldes wurde die Fortführung des traditionellen<br />
<strong>Erle</strong>nhochwaldbetriebes bei einer maximalen<br />
Kahlschlaggröße von einem Hektar und angepassten<br />
Bodenarbeiten vereinbart.<br />
Für die <strong>Erle</strong>nbestände auf den Standorten des<br />
Traubeneichen-Eschen-Waldes sieht der PEP die<br />
langfristige Entwicklung zu naturnahen Auenwäldern<br />
mit den Baumarten Esche, Flatterulme, Stieleiche<br />
und anderen vor (siehe dazu Tab. 5).<br />
Mit diesem Konzept ist die Entwicklung naturnaher,<br />
standortgerechter Wälder bei gleichzeitiger<br />
Bewahrung des traditionellen Hochwaldbetriebes<br />
auf den dafür geeigneten Standorten gesichert.<br />
<strong>Die</strong> Verjüngung der <strong>Schwarz</strong>-<br />
<strong>Erle</strong> im Hochwaldbetrieb<br />
<strong>Die</strong> planmäßige Verjüngung ist die Voraussetzung<br />
für den angestrebten Erhalt der <strong>Erle</strong>n-Hochwälder<br />
des Spreewaldes.<br />
Dabei sind folgende Eigenschaften dieser Baumart<br />
zu berücksichtigen:<br />
– Sie produziert im Reifezustand erhebliche Samenmengen.<br />
Vollernten sind in der Regel alle 3 bis<br />
4 Jahre zu erwarten (SCHUBERT o. J.). <strong>Die</strong><br />
Keimfähigkeit des handelsüblichen Saatgutes<br />
ist allerdings relativ gering (25 bis 40 %). Für<br />
sein Keimen und das Auflaufen ist Kontakt zum<br />
Mineralboden erforderlich.<br />
– Sie besitzt ein ausgeprägtes Ausschlagvermögen<br />
aus gesunden Stöcken (TESCHE et al.<br />
1985). <strong>Die</strong> Stöcke sind dabei möglichst tief zu<br />
schneiden.<br />
– Sie benötigt für ein gutes Wachstum ausreichenden<br />
Lichtgenuss. Überschattung in der Aufwuchs-<br />
und Jungwuchsphase bewirkt deutliche


![Die Schwarz-Erle (Alnus glutinosa [L.] GAERTN.) - Landesbetrieb ...](https://img.yumpu.com/2018570/115/500x640/die-schwarz-erle-alnus-glutinosa-l-gaertn-landesbetrieb-.jpg)