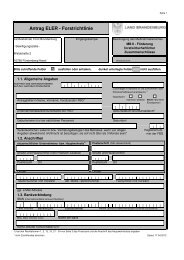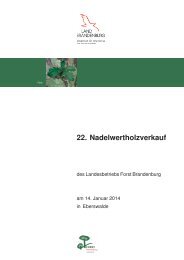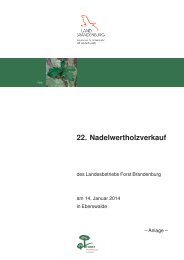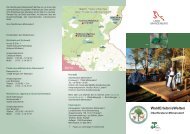Die Schwarz-Erle (Alnus glutinosa [L.] GAERTN.) - Landesbetrieb ...
Die Schwarz-Erle (Alnus glutinosa [L.] GAERTN.) - Landesbetrieb ...
Die Schwarz-Erle (Alnus glutinosa [L.] GAERTN.) - Landesbetrieb ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Entwicklungen der Waldstandorte<br />
und ihre waldbaulichen<br />
Konsequenzen – Ergebnisse<br />
vertiefender standortskundlicher,<br />
bodenkundlicher und<br />
hydrologischer Untersuchungen<br />
Zielgerichtete forstliche Bewirtschaftung der<br />
<strong>Schwarz</strong>-<strong>Erle</strong>nbestände setzt zwingend die Kenntnis<br />
und Ausnutzung der vorliegenden Standorte und<br />
ihrer Eigenschaften voraus. Sie bilden die Grundlage<br />
für die Wahl des optimalen Bestandeszieltyps<br />
(BZT) nach den Optimalitätskriterien des Ökogramms<br />
der SER. Der BZT ist zudem mit einem<br />
Biotopzieltyp untersetzt. Das Ökogramm verdeutlicht<br />
die bereits angesprochene enge Bindung der<br />
SER-Bestände an Standorte mit guter Nährstoffund<br />
hoher Wasserversorgung.<br />
Seit der flächendeckenden Standortskartierung<br />
von 1960–1962 unterlag der Wasserhaushalt des<br />
DIE BEWIRTSCHAFTUNG DER SCHWARZ-ERLE IM SPREEWALD<br />
Spreewaldes erheblichen anthropogen bedingten<br />
Veränderungen, vor allem durch den Bergbau. <strong>Die</strong>s<br />
und die Vergleiche der damaligen Standortdaten<br />
mit den gegenwärtigen Zuständen legte den Verdacht<br />
auf größerflächige Veränderungen als Folge<br />
der Grundwasserabsenkung und forstlicher Bewirtschaftungsmaßnahmen<br />
nahe. Auch der Vergleich<br />
vegetationskundlicher Aufnahmen aus den 1950er<br />
und 1990er Jahren deutete auf eine zunehmende<br />
Austrocknung der Waldstandorte hin.<br />
Er war Anlass, im Zuge der Erarbeitung der PEP<br />
differenzierte Entwicklungsziele für die <strong>Erle</strong>nbestände<br />
zu entwickeln: Naturnahe Auenwälder auf<br />
Standorten des TEI-ES-Waldes; <strong>Erle</strong>nhochwaldbetrieb<br />
auf Standorten des Rasenschmielen-<strong>Erle</strong>n-<br />
Waldes, des krautreichen <strong>Erle</strong>nwaldes, des Brennessel-<strong>Erle</strong>n-Waldes;<br />
Nutzungsverzicht auf Standorten<br />
des Wasserfeder-<strong>Erle</strong>n-Waldes, des Schilf-<br />
<strong>Erle</strong>n-Waldes und Teilen des Großseggen-<strong>Erle</strong>n-<br />
Waldes.<br />
Aus der Abstimmung der Fachplanungen des<br />
Biosphärenreservates und des Amtes für Forstwirtschaft<br />
ergaben sich Fragen nach dem Einfluss von<br />
Abb. 6: Ökogramm mit Bestandeszieltypen (Hauptbaumarten in Fettdruck), Baumart <strong>Schwarz</strong>-, Rot-<br />
<strong>Erle</strong> (RER) Klimastufe f, m, t<br />
119


![Die Schwarz-Erle (Alnus glutinosa [L.] GAERTN.) - Landesbetrieb ...](https://img.yumpu.com/2018570/120/500x640/die-schwarz-erle-alnus-glutinosa-l-gaertn-landesbetrieb-.jpg)