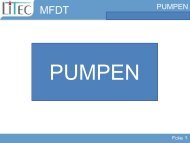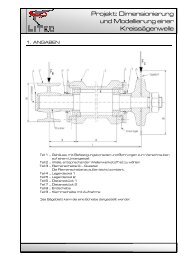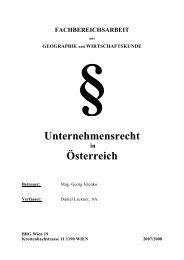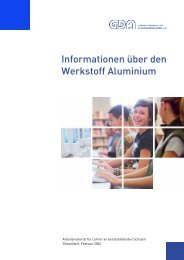ERSTER TEIL: Handels- und Unternehmensrecht - oeppi
ERSTER TEIL: Handels- und Unternehmensrecht - oeppi
ERSTER TEIL: Handels- und Unternehmensrecht - oeppi
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Zusammenfassung CASEBOOK <strong>Handels</strong>- <strong>und</strong> Gesellschaftsrecht<br />
Ausgabe 2006/adaptiert gem. 2. Auflage 2008/adaptiert gem. 3. Auflage 2010<br />
o Haftung bei unternehmensbezogenen Geschäften:<br />
Anders als die allgemeinene Haftung nach Zivilrecht:<br />
höherer Sorgfaltsmaßstab<br />
U hat für die Sorgfalt eines ordentlichen Unternehmers einzustehen, nach objektiven Kriterien.<br />
Es zählt der Grad der Aufmerksamkeit <strong>und</strong> des Fleißes, als auch seine Fähigkeiten <strong>und</strong><br />
Kenntnisse (differenziert nach Branche <strong>und</strong> U). Verhalten von Gehilfen wird dem U zugerechnet.<br />
Anwendung auf vertraglichen <strong>und</strong> vorvertraglichen Bereich.<br />
Erweiterung des Umfangs der Schadenersatzpflicht<br />
Gilt zwischen zwei Unternehmern <strong>und</strong> umfasst ab grober Fahrlässigkeit auch den Ersatz des<br />
entgangenen Gewinns.<br />
KONTOKORRENT gem. § 365 UGB<br />
o Nach Kontokorrentvertrag werden in einer laufenden Geschäftsverbindung die jeweils stammenden<br />
Ansprüche <strong>und</strong> Leistungen samt Zinsen in regelmäßigen Abständen (gesetzlich ein Jahr) verrechnet<br />
<strong>und</strong> der dabei entstehende Überschuss (Saldo) begründet eine neue Forderung. Diese Einrichtung<br />
dient der Erleichterung <strong>und</strong> Vereinfachung des Geschäftsverkehrs <strong>und</strong> erfüllt eine<br />
Vereinheitlichungsfunktion, da durch ein Saldoanerkenntnis die verschiedenen Rechtsgr<strong>und</strong>lagen<br />
der einzelnen Forderungen ersetzt werden.<br />
Ablauf: Der nach Abrechnung entstandene Saldo kann selbstständig eingeklagt werde (kausale<br />
Saldoforderung), ist aber vom Bestand der Einzelforderungen abhängig. Es erfolgt idR das<br />
Saldoanerkenntnis, welches die Annahme des Angebots (Saldoergebnis) durch den Partner der<br />
verrechnenden Partei ist. Das Saldoanerkenntnis entfaltet konstitutive Wirkung.<br />
Kausale Saldoforderung: dies ist das Ergebnis der Verrechnung. Es ergibt sich die Frage, wenn es<br />
zu keinem Saldoanerkenntnis kommt <strong>und</strong> die kausale Saldoforderung eingeklagt wird, wie die<br />
einzelnen Forderungen rechtlich einzuordnen sind (Verjährung, Gerichtsstand etc.). Die Parteien<br />
vereinbaren für diesen Fall einvernehmlich darüber, welche Posten ausgeglichen werden sollen<br />
(ausdrücklich oder schlüssig). Mangels solcher Vereinbarung tritt die gesetzliche<br />
Tilgungsreihenfolge zur Anwendung: Zuerst Zinsen, dann Kapital. Bei mehreren<br />
Kapitalforderungen zuerst jene die eingefordert oder fällig sind. Bei Fehlschlagen tritt die<br />
Tilgungsreihenfolge nach Beschwerlichkeit für den Verpflichteten ein (zuerst sind jene getilgt,<br />
die dem Verpflichteten am beschwerlichsten sind – höher verzinsliche Forderungen, gesicherte<br />
Forderungen etc.)<br />
Wirkungen des Saldoanerkenntnisses: Wird als ein abgeschwächter, abstrakter<br />
Verpflichtungsgr<strong>und</strong> gesehen, der neben die im kausalen Saldo fortbestehenden<br />
Einzelansprüche tritt. Der Überschussberechtigte hat Anspruch auf die Einzelansprüche <strong>und</strong><br />
auch auf den festgestellten Saldo. Der Gegenpartei steht die Einrede der ungerechtfertigten<br />
Bereicherung zu.<br />
Kontokorrentgeb<strong>und</strong>enheit: Bereits mit Einstellung in das KK verlieren die einzelnen<br />
Forderungen ihre Selbständigkeit; dh sie können ohne Zustimmung des KK Partner nicht mehr<br />
selbständig geltend gemacht, abgetreten oder verpfändet werden; Gläubiger können nur den<br />
aktuellen oder den zukünftigen Saldo zum nächsten Abschlussstichtag pfänden.<br />
GUTGLÄUBIGER EIGENTUMS‐ UND PFANDRECHTSERWERB:<br />
o Für den Eigentumserwerb sind Titel, Modus <strong>und</strong> die Berechtigung des Vormanns notwendig. Fehlt<br />
die Berechtigung des Vormanns, substituiert § 367 ABGB diesen durch drei Gutglaubenstatbestände:<br />
Voraussetzungen:<br />
Bewegliche Körperliche Sache, entgeltlicher Titel, entsprechender Modus <strong>und</strong> (nach § 367<br />
ABGB) der gutgläubige Erwerb in einer öffentlichen Versteigerung, von einem Unternehmer im<br />
gewöhnlich Betrieb seines Unternehmens oder vom Vertrauensmann des Eigentümers, dem die<br />
Sache anvertraut wurde.<br />
Bei Erwerb von einem Unternehmer begründen betriebsuntypische oder betriebsfremde<br />
Geschäfte keinen entsprechenden Vertrauenstatbestand. Die Gutgläubigkeit/Redlichkeit des<br />
Erwerbers wird bereits bei leichter Fahrlässigkeit ausgeschlossen. (Achtung: Scheinunternehmer<br />
November 2010 Seite 11 von 49