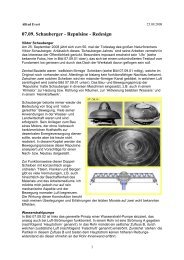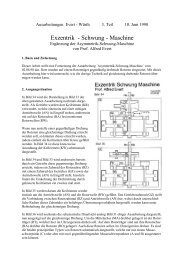Äther-Physik und -Philosophie - Evert
Äther-Physik und -Philosophie - Evert
Äther-Physik und -Philosophie - Evert
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Umwandlung von ein bißchen Wärme handelt. Andererseits hatte ich verbal schon oft beschrieben,<br />
dass <strong>und</strong> warum per Sog geordnete Strömungen entstehen <strong>und</strong> darin die Partikel relativ parallel <strong>und</strong><br />
nahe beieinander in ähnliche Richtungen fliegen (also Dichte <strong>und</strong> Geschwindigkeit = Wärme involviert<br />
sind). Aber jetzt erst ist mir gelungen, die Sachverhalte auch graphisch <strong>und</strong> logisch schlüssig<br />
darzustellen (siehe Bild 05.14.14, Kapitel 05.13. ´Explosion / Implosion´).<br />
Bei allen Anwendungen von Druck bewegt sich<br />
eine ´Wand´ vorwärts gegen Fluid, beispielsweise<br />
Kolben im Zylinder oder Schaufeln einer<br />
Pumpe. Partikel fliegen mit normaler molekularer<br />
Geschwindigkeit gegen die Wand, werden<br />
reflektiert <strong>und</strong> fliegen beschleunigt zurück, was<br />
gleichbedeutend mit erhöhter Wärme ist. Da die<br />
Wand plus beschleunigte Partikel fortwährend in<br />
Bereiche bislang nicht tangierten Fluids<br />
vorrücken, bildet sich ein Stau, was gleichbedeutend<br />
mit erhöhtem statischen Druck ist.<br />
Die Anwendung von Druck auf ein Fluid bedeutet<br />
also Produktion von Wärme <strong>und</strong> zugleich<br />
unvermeidbar auch Produktion von Druck, womit<br />
der Widerstand gegen die Wand im Quadrat zu<br />
ihrer Geschwindigkeit anwächst. Das ist gängige<br />
Technik, egal ob bei der Produktion von Pressluft<br />
<strong>und</strong> allen auf Verbrennung basierenden<br />
Prozessen. Bei offenen Systemen verpufft die<br />
produzierte Wärme total in die Umgebung, bei<br />
geschlossenen Systemen unweigerlich<br />
zumindest ein Teil davon.<br />
Auch bei Anwendung von Sog fliegen Partikel<br />
mit normaler molekularer Geschwindigkeit gegen vorige ´Wand´, die jedoch gleichzeitig zurück weicht,<br />
d.h. erst verspätet getroffen wird. Reflektierte Partikel fliegen mit entsprechend reduzierter<br />
Geschwindigkeit zurück, was gleichbedeutend ist mit geringerer Wärme. Aus Anwendung von Sog<br />
resultiert also Abkühlung bzw. relative Kälte - <strong>und</strong> diese langsamen Partikel fliegen weniger weit je<br />
Zeiteinheit, d.h. beanspruchen weniger Volumen bzw. deren Dichte ist entsprechend höher.<br />
In beiden Situationen wird also Strömung produziert, letztlich entsprechend zur Geschwindigkeit der<br />
Wandbewegung. Aber die Geschwindigkeit kommt einmal zustande aus erhöhter Wärme mit<br />
erhöhtem Bedarf an Volumen (<strong>und</strong> da dieses nicht verfügbar ist, zugleich mit erhöhtem Gegendruck-<br />
Widerstand). Bei Sog dagegen wird Raum zur Verfügung gestellt, in den hinein Partikel fast<br />
ungehindert fallen können, weil die Geschwindigkeit der reflektierten Partikel verzögert wird, ihre<br />
erhöhte Dichte fortwährend neues ´Teil-Vakuum´ darstellt (wobei jede schnelle Strömung gegenüber<br />
langsamer Strömung die gleiche Funktion wie diese ´zurückweichende Wand´ erfüllt).<br />
Produktive Kälte<br />
Ich stelle nun also fest, im Gegensatz zu meinen früheren Aussagen: ja, es ist Thermodynamik<br />
involviert. Der geringere Volumensbedarf der ´abgekühlten´ Partikel wird in geschlossenen Systemen<br />
nicht genutzt - <strong>und</strong> daraus resultiert der generelle Wärmeverlust nach den Erfahrungssätzen der<br />
Thermodynamik. In obigen offenen Systemen wird dieser Verlust jedoch ausgeglichen durch seitlichen<br />
Zufluss ´neuer´ Partikel - <strong>und</strong> daraus ergibt sich die erhöhte Masse, Dichte, Ordnung <strong>und</strong> kinetische<br />
Energie der per Sog generierten Strömungen. In Kenntnis dieses Sachverhalts kann aber auch in<br />
geschlossenen Kreisläufen mit Soganwendung diese (zulasten statischen Drucks) erhöhte kinetische<br />
Druckenergie für externe Zwecke genutzt werden.<br />
Diese Sicht der Thermodynamik ist also konträr zur geläufigen Interpretation <strong>und</strong> ergibt konträre<br />
Schlussfolgerung: man muss Kälte schaffen, um erhöhte Dichte zu erzeugen <strong>und</strong> zugleich Strömung<br />
in die damit generierte relative Leere hinein zu gewinnen, mit im Quadrat zur Geschwindigkeit<br />
fallendem Widerstand, sprich im Idealfall mit null Energie-Einsatz (siehe obige rein passive<br />
Maßnahmen z.B. gekrümmter Flächen).<br />
104