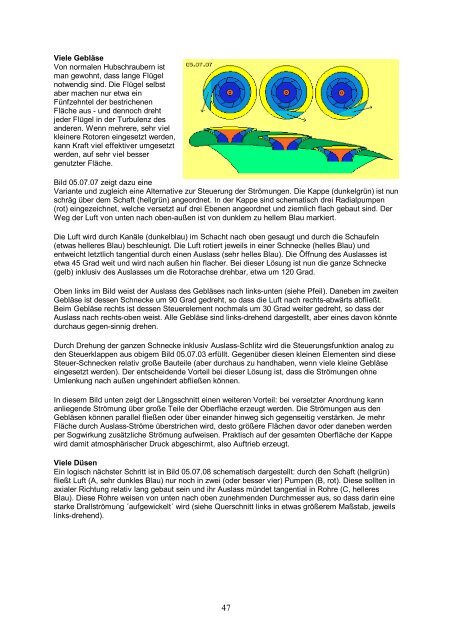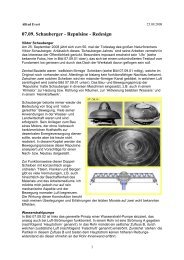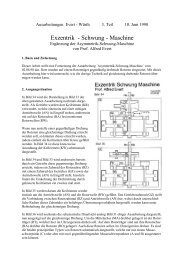Äther-Physik und -Philosophie - Evert
Äther-Physik und -Philosophie - Evert
Äther-Physik und -Philosophie - Evert
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Viele Gebläse<br />
Von normalen Hubschraubern ist<br />
man gewohnt, dass lange Flügel<br />
notwendig sind. Die Flügel selbst<br />
aber machen nur etwa ein<br />
Fünfzehntel der bestrichenen<br />
Fläche aus - <strong>und</strong> dennoch dreht<br />
jeder Flügel in der Turbulenz des<br />
anderen. Wenn mehrere, sehr viel<br />
kleinere Rotoren eingesetzt werden,<br />
kann Kraft viel effektiver umgesetzt<br />
werden, auf sehr viel besser<br />
genutzter Fläche.<br />
Bild 05.07.07 zeigt dazu eine<br />
Variante <strong>und</strong> zugleich eine Alternative zur Steuerung der Strömungen. Die Kappe (dunkelgrün) ist nun<br />
schräg über dem Schaft (hellgrün) angeordnet. In der Kappe sind schematisch drei Radialpumpen<br />
(rot) eingezeichnet, welche versetzt auf drei Ebenen angeordnet <strong>und</strong> ziemlich flach gebaut sind. Der<br />
Weg der Luft von unten nach oben-außen ist von dunklem zu hellem Blau markiert.<br />
Die Luft wird durch Kanäle (dunkelblau) im Schacht nach oben gesaugt <strong>und</strong> durch die Schaufeln<br />
(etwas helleres Blau) beschleunigt. Die Luft rotiert jeweils in einer Schnecke (helles Blau) <strong>und</strong><br />
entweicht letztlich tangential durch einen Auslass (sehr helles Blau). Die Öffnung des Auslasses ist<br />
etwa 45 Grad weit <strong>und</strong> wird nach außen hin flacher. Bei dieser Lösung ist nun die ganze Schnecke<br />
(gelb) inklusiv des Auslasses um die Rotorachse drehbar, etwa um 120 Grad.<br />
Oben links im Bild weist der Auslass des Gebläses nach links-unten (siehe Pfeil). Daneben im zweiten<br />
Gebläse ist dessen Schnecke um 90 Grad gedreht, so dass die Luft nach rechts-abwärts abfließt.<br />
Beim Gebläse rechts ist dessen Steuerelement nochmals um 30 Grad weiter gedreht, so dass der<br />
Auslass nach rechts-oben weist. Alle Gebläse sind links-drehend dargestellt, aber eines davon könnte<br />
durchaus gegen-sinnig drehen.<br />
Durch Drehung der ganzen Schnecke inklusiv Auslass-Schlitz wird die Steuerungsfunktion analog zu<br />
den Steuerklappen aus obigem Bild 05.07.03 erfüllt. Gegenüber diesen kleinen Elementen sind diese<br />
Steuer-Schnecken relativ große Bauteile (aber durchaus zu handhaben, wenn viele kleine Gebläse<br />
eingesetzt werden). Der entscheidende Vorteil bei dieser Lösung ist, dass die Strömungen ohne<br />
Umlenkung nach außen ungehindert abfließen können.<br />
In diesem Bild unten zeigt der Längsschnitt einen weiteren Vorteil: bei versetzter Anordnung kann<br />
anliegende Strömung über große Teile der Oberfläche erzeugt werden. Die Strömungen aus den<br />
Gebläsen können parallel fließen oder über einander hinweg sich gegenseitig verstärken. Je mehr<br />
Fläche durch Auslass-Ströme überstrichen wird, desto größere Flächen davor oder daneben werden<br />
per Sogwirkung zusätzliche Strömung aufweisen. Praktisch auf der gesamten Oberfläche der Kappe<br />
wird damit atmosphärischer Druck abgeschirmt, also Auftrieb erzeugt.<br />
Viele Düsen<br />
Ein logisch nächster Schritt ist in Bild 05.07.08 schematisch dargestellt: durch den Schaft (hellgrün)<br />
fließt Luft (A, sehr dunkles Blau) nur noch in zwei (oder besser vier) Pumpen (B, rot). Diese sollten in<br />
axialer Richtung relativ lang gebaut sein <strong>und</strong> ihr Auslass mündet tangential in Rohre (C, helleres<br />
Blau). Diese Rohre weisen von unten nach oben zunehmenden Durchmesser aus, so dass darin eine<br />
starke Drallströmung ´aufgewickelt´ wird (siehe Querschnitt links in etwas größerem Maßstab, jeweils<br />
links-drehend).<br />
47