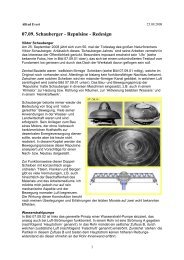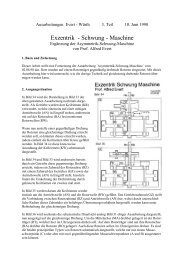Äther-Physik und -Philosophie - Evert
Äther-Physik und -Philosophie - Evert
Äther-Physik und -Philosophie - Evert
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
05.11. Spiral-Kanal-Motor<br />
Druck erzeugt Gegendruck<br />
Im vorigen Kapitel wurde festgestellt, dass gängige Maschinen vorwiegend auf der Anwendung von<br />
Druck beruhen, z.B. Wasserturbine oder Verbrennungsmotor. Druck erzeugt Gegendruck, bei Gasen<br />
sogar Widerstand im Quadrat. Per Druck kann das interne Bewegungspotential der Fluide nicht<br />
genutzt werden, sondern nur per Sog lassen sich automatisch beschleunigende Strömungen<br />
generieren, bis zur Schallgeschwindigkeit. In diesem Kapitel soll beispielhaft aufgezeigt werden, wie<br />
diese ´Freie Energie´ nutzbar ist.<br />
In Bild 05.11.01 sind schematisch Schnitte<br />
durch normale Radialpumpen dargestellt<br />
(immer linksdrehend unterstellt). Im<br />
Querschnitt bei A sind im Rotor (rot) sechs<br />
gerade Kanäle (hellrot) dargestellt, durch<br />
welche Fluid nach außen gefördert wird. Das<br />
Fluid bewegt sich dabei im Raum auf spiralig<br />
gekrümmter Bahn (siehe Pfeil) nach außen,<br />
bei dieser Maschine als sechs einzelne Strahle. Am Auslass einer Pumpe ist in aller Regel<br />
durchgängiger Abfluss vorteilhaft, so dass am gesamten Umfang das Fluid als ein flächiger Strahl<br />
austritt.<br />
Dies wird erreicht indem der Querschnitt der Kanäle nach außen hin gestreckt, also länger <strong>und</strong><br />
zugleich flacher wird, wie schematisch im Längsschnitt bei F dargestellt ist. In Querschnitt B ist eine<br />
nachteilige Erscheinung dieser Pumpen dargestellt: das Fluid staut sich an der hinteren (Druck-)<br />
Wand C der Kanäle, woraus zunehmender Widerstand erwächst. Weiter vorn im Kanal herrscht<br />
geringere Dichte D <strong>und</strong> ganz vorn sogar relativer Unterdruck E (durch unterschiedliches Blau<br />
markiert).<br />
Sog erzeugt Bewegung<br />
Natürlich entweichen Teile des Fluids aus<br />
dem hinteren, dichten Bereich nach vorn, sie<br />
werden aber von der Druckwand immer<br />
wieder eingeholt. In Bild 05.11.02 ist<br />
dargestellt, wie diese relative Leere entlang<br />
der Sog-Wand einer Pumpe nutzbar wird.<br />
Oben quer ist ein Schnitt durch drei Kanäle<br />
dargestellt, also mit Blick radial zur<br />
Systemachse. Der Rotor bewegt sich von<br />
rechts nach links, so dass an der rechten<br />
Druckwand sich der Stau C befindet, weiter<br />
nach vorn die Bereiche D <strong>und</strong> E geringerer<br />
Dichte. Der prinzipielle Ansatz zur Nutzung<br />
dieser relativen Leere liegt nun darin, dass<br />
vorn bei der Sogwand ´Falschluft´ G durch<br />
eine seitliche Öffnung einströmen kann.<br />
In diesem Bild unten rechts ist schematisch<br />
ein Längsschnitt dargestellt durch den Rotor (rot) <strong>und</strong> durch die Kanäle (blau), wobei nun der<br />
Querschnitt dieser Kanäle von innen nach außen konstant bleibt. Der Einlass F erfolgt wiederum vornmittig<br />
in axiale Richtung, der Auslass H hinten-außen in radiale Richtung, aber die gesamte Fläche am<br />
Auslass ist damit viel zu groß gegenüber der Fläche des mittigen Einlasses.<br />
In diesem Bild unten links ist schematisch ein Querschnitt durch den Rotor dargestellt. Durch den<br />
mittigen Einlass F (blau) strömt Fluid in die sechs Kanäle, aus denen außen der Abfluss H erfolgt bzw.<br />
das Fluid im Raum auf gekrümmter Bahn I nach außen fließt. Zusätzlich sind nun schlitzförmige<br />
Öffnungen G (hellrot) eingezeichnet, welche entlang jeder Sog-Wand der Kanäle angelegt sind. Auch<br />
im Längsschnitt ist die generelle Position der zusätzlichen Längsöffnungen G (hellrot) skizziert. Diese<br />
76