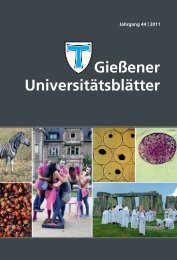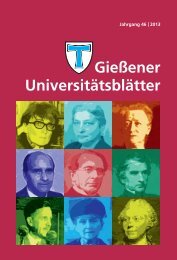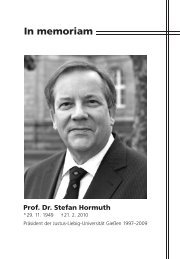Universitätsblätter 2009 - Gießener Hochschulgesellschaft
Universitätsblätter 2009 - Gießener Hochschulgesellschaft
Universitätsblätter 2009 - Gießener Hochschulgesellschaft
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Warum diese beiden Werke?<br />
Kurt Weill wurde am 2. März 1900 als Sohn des<br />
jüdischen Kantors Albert Weill in Dessau geboren.<br />
Sein Kompositionsstudium absolvierte er<br />
bei Engelbert Humperdinck und Feruccio<br />
Busoni. Die Zeit bei Busoni war für Weills Opernästhetik<br />
wegweisend. Wie sein Lehrer lehnte<br />
auch er die „Arie“ als wesentlichen Opernbestandteil<br />
ab. Im Gegensatz zu seinem Lehrer<br />
war er allerdings auf der Suche nach einem<br />
adäquaten Ersatz. So erfand Weill stattdessen<br />
den „Song“. In seiner Zusammenarbeit mit<br />
Georg Kaiser, Yvan Goll und natürlich Bertolt<br />
Brecht entstanden zahlreiche solcher Songs.<br />
Neben Paul Hindemith galt Kurt Weill in der<br />
letzten Dekade der Weimarer Republik als der<br />
führende Komponist; bis heute gelten Werke<br />
wie die „Dreigroschenoper“, „Aufstieg und<br />
Fall der Stadt Mahagonny“ oder auch „Die sieben<br />
Todsünden“ als Klassiker. Seine 2. Sinfonie<br />
schrieb Weill 1933 in dem festen Bewusstsein,<br />
emigrieren zu müssen. Die Komposition begann<br />
er noch in Berlin, sie wurde aber erst in<br />
Paris vollendet, kurz bevor Weill endgültig nach<br />
Amerika auswanderte. Das Werk wurde am<br />
11. Oktober 1934 in Amsterdam vom Concertgebouw<br />
Orchester unter der Leitung von Bruno<br />
Walter uraufgeführt. Nach seiner Emigration<br />
schrieb Weill nahezu ausschließlich kommerzielle<br />
Musik für den Broadway, aus dem naheliegenden<br />
Grund, Geld verdienen zu müssen.<br />
Außerdem hatte er den Anspruch, ein so guter<br />
Amerikaner wie möglich werden zu wollen,<br />
was 1943 zum Erhalt der amerikanischen<br />
Staatsbürgerschaft führte. Man kann sagen,<br />
dass die 2. Sinfonie Kurt Weills Abgesang auf<br />
die mitteleuropäische Musikkultur ist.<br />
Zur gleichen Zeit versuchte ein schon damals<br />
38-jähriger Komponist namens Carl Orff (geb.<br />
1895), sich einen Namen im Münchner Musikleben<br />
zu machen. Er selbst hatte bei Anton<br />
Beer-Wallbrunn und Herrmann Zilcher studiert<br />
und lebte seit 1919 als freier Komponist in<br />
München. 1934 entdeckte er die 1847 im<br />
Druck erschienenen „Carmina Burana“ aus<br />
dem 12. Jahrhundert und beschloss, sie zu vertonen.<br />
Die Komposition, die daraus entstand,<br />
hatte in ihrer Klangästhetik mit den vorherigen<br />
Werken Orffs nichts gemein. Der große Erfolg,<br />
gerade auch bei den Kulturfunktionären der<br />
neuen Zeit, brachte Orff zu der Entscheidung,<br />
die Verbreitung und Aufführung aller seiner<br />
Werke, die vor 1936, also vor den „Carmina<br />
Burana“ entstanden waren, zu verbieten. Die<br />
„Carmina Burana“ galten forthin als Orffs erstes<br />
Werk.<br />
Carl Orffs Verhalten in der Zeit des Dritten<br />
Reichs ist in den letzten Jahren verstärkt in die<br />
Diskussion gekommen, besonders durch die<br />
Veröffentlichungen des kanadischen Historikers<br />
Michael H. Kater. Es ergibt sich das Bild<br />
eines unpolitischen, auch nicht an Politik interessierten<br />
Komponisten, der es allerdings vortrefflich<br />
verstand, sich mit den Machthabern<br />
zu arrangieren, um ungehindert seinen künstlerischen<br />
Weg gehen zu können, und der es<br />
genoss, als bedeutender Komponist seiner<br />
Zeit hofiert zu werden. Zur Absicherung seiner<br />
Position nahm er sogar zwei Kompositionsaufträge<br />
der Machthaber an: Sein „Olympischer<br />
Reigen“ wurde zur Eröffnung der<br />
Olympischen Spiele 1936 in Berlin aufgeführt,<br />
sein „Sommernachtstraum“, der zwar schon<br />
1917 komponiert worden war, nun 1939 aber<br />
gründlich revidiert wurde, sollte als Ersatz für<br />
Mendelssohn-Bartholdys Komposition herhalten,<br />
da dieser als Jude geächtet war. Nach<br />
dem Zweiten Weltkrieg versuchte Carl Orff<br />
sich gegenüber der Entnazifizierungskommission<br />
als Mitglied der „Weißen Rose“ darzustellen,<br />
da er persönlicher Freund von Kurt<br />
Huber, einem der Gründer der „Weißen Rose“,<br />
war. Dies entsprach nicht der Wahrheit.<br />
Der Tatsache, dass mit Newell Jenkins einer<br />
seiner ehemaligen Schüler sein Vernehmungsoffizier<br />
war, hatte es Orff zu verdanken, nur<br />
als Mitläufer eingestuft zu werden und damit<br />
seinen Beruf wieder ausüben zu dürfen. Im<br />
Münchner Musikleben spielte er sofort nach<br />
dem Krieg die gleiche wesentliche Rolle wie<br />
zuvor. Insofern kann man die „Carmina<br />
Burana“ als Geburtsstück einer Komponistenkarriere<br />
ansehen, der wechselnde politische<br />
Systeme nichts anhaben konnten.<br />
Die Gegenübersetzung dieser beiden Schlüsselwerke<br />
für Weill und Orff machte zusammen<br />
mit der sie verbindenden Licht- und Videoinsze-<br />
153