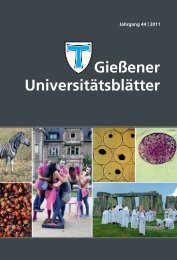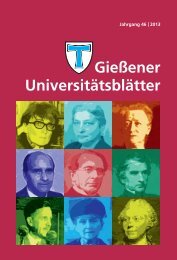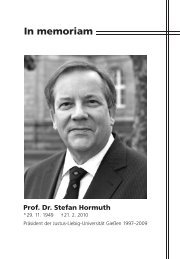Universitätsblätter 2009 - Gießener Hochschulgesellschaft
Universitätsblätter 2009 - Gießener Hochschulgesellschaft
Universitätsblätter 2009 - Gießener Hochschulgesellschaft
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Erkrankungen, die durch Hypoxie, oxidativen<br />
Stress oder gestörtes ROS-Signaling ausgelöst<br />
werden, zu beschreiten.<br />
Projektbereich F:<br />
Infektion, Inflammation und Kontrolle<br />
der Barrierefunktion<br />
Die Aktivierung von Entzündungsreaktionen<br />
in Lunge und Herz, sei es durch infektiöse<br />
oder nicht-infektiöse Vorgänge, kann in tiefgreifender<br />
Weise die sensible Barrierefunktion<br />
äußerer und innerer Grenzflächen der Gefäße<br />
und Organe beeinträchtigen, die die Trennung<br />
von löslichen und zellulären Komponenten<br />
aufrecht erhält. Bislang unzureichend charakterisiert<br />
sind hier zum einen die molekularen<br />
Schalter, die die normale Schutzfunktion der<br />
Entzündung (Erregerabwehr und Gleichgewicht<br />
im Gewebe) in eine unkontrollierte Gewebsschädigung<br />
mit Verlust der Schrankenfunktion<br />
entgleisen lassen, zum anderen<br />
kompensatorische Mechanismen, die die Barrierefunktion<br />
re-etablieren und die Entzündung<br />
abräumen. Im Projektbereich F werden<br />
in Gewebs- und Organmodellen, in Infektionsund<br />
Entzündungsmodellen an Tieren und im<br />
klinischen Kontext zelluläre Signalpfade organ-ständiger<br />
und durch entzündliche Vorgänge<br />
zugewanderter Zellen (z. B. Zellen der<br />
körpereigenen Immunabwehr) dahingehend<br />
bewertet, ob sie<br />
1) die Integrität der Barrieren in Herz und Lunge<br />
im Entzündungsgeschehen schützen oder<br />
regenerieren,<br />
2) die gewebsschädigende Inflammation bei<br />
Erhaltung der Wirtsabwehr und Reparaturkapazität<br />
dämpfen und<br />
3) die lokale Auflösung der Entzündung beschleunigen<br />
oder die Reparaturkapazität erhöhen.<br />
Identifizierte Schlüsselmoleküle werden zunächst<br />
in Tiermodellen, in denen die betreffenden<br />
Gene fehlen oder übermäßig aktiviert<br />
sind, auf ihre Eignung als therapeutische Ziele<br />
für selektive Eingriffe in den Entzündungsvorgang<br />
untersucht. Im Anschluss werden geeignete<br />
Substanzen in klinischen Studien und<br />
Behandlungskonzepten evaluiert, für deren<br />
rasche Umsetzung die kooperative Struktur<br />
des ECCPS eine ideale Plattform bietet.<br />
Projektbereich G:<br />
Vaskuläre Konsequenzen des<br />
„Metabolischen Syndroms“<br />
Das Metabolische Syndrom, definiert als Übergangsstatus<br />
zwischen dem normalen physiologischen<br />
Zustand und der pathologischen Situation<br />
eines Typ-2-Diabetes, findet sich in der<br />
Bevölkerung bei mehr als 20% der Erwachsenen.<br />
Aufgrund der erwarteten epidemischen<br />
Zunahme wird es ein erhebliches sozio-ökonomisches<br />
Problem in den nächsten 20 Jahren darstellen.<br />
Die mit kardiovaskulären Komplikationen<br />
verknüpfte Entwicklung eines Metabolischen<br />
Syndroms ist kausal-mechanistisch<br />
unklar; sie steigt mit dem „body-mass-index“,<br />
mit dem Alter sowie nach der Menopause. Weitere<br />
Risikofaktoren (wie Bewegungsarmut) tragen<br />
zu erhöhter Morbidität und Mortalität der<br />
Patienten bei. In dem Projektbereich G sollen die<br />
Mechanismen, die zum Metabolischen Syndrom<br />
führen und damit die Voraussetzung für vaskuläre<br />
Erkrankungen liefern, identifiziert werden.<br />
Dabei liegen die Schwerpunkte in der strukturellen<br />
und funktionellen Analyse von irreversibel<br />
modifizierten plasmatischen und zellulären Proteinen,<br />
von Mikropartikeln sowie Adipokinen<br />
(Zelle-zu-Zelle-Botenstoffen, die vom Fettgewebe<br />
produziert werden) und ihren Wechselwirkungen<br />
mit vaskulären Zellen. Die aus diesen<br />
Interaktionen resultierenden Störungen des vaskulären<br />
Gleichgewichts sollen durch den integrativen<br />
Einsatz von in-vitro-Analytik (wie Analyse<br />
des Proteinbestandes) und (genetisch<br />
veränderten) Tiermodellen der Entzündung und<br />
Angiogenese studiert werden. Das übergeordnete<br />
Ziel ist die Charakterisierung von Pathomechanismen<br />
der am Metabolischen Syndrom<br />
kausal beteiligten Komponenten und die Identifizierung<br />
von neuen molekularen Zielstrukturen<br />
(Targets) für die Therapie der kardiovaskulären<br />
Folgeerkrankungen. Gleichzeitig sollen bei bislang<br />
rein empirisch für die Behandlung des Metabolischen<br />
Syndroms eingesetzten Medikamenten<br />
wie ACE-Hemmern (Therapie des<br />
Bluthochdruckes und der chronischen Herzin-<br />
99