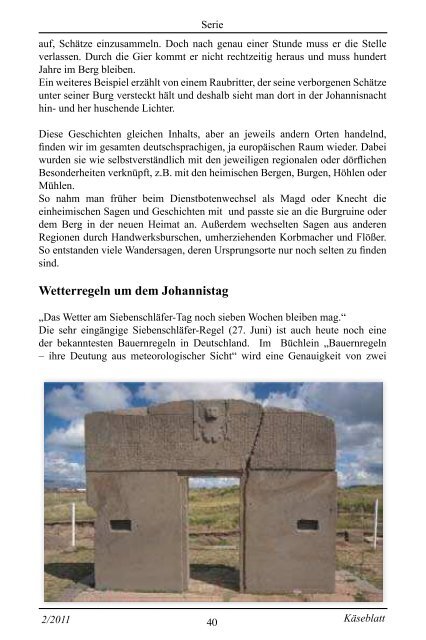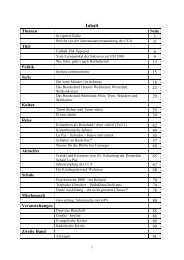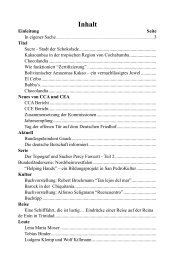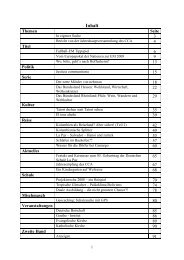II - CCA Monatsblatt
II - CCA Monatsblatt
II - CCA Monatsblatt
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
In eigener SerieSache<br />
auf, Schätze einzusammeln. Doch nach genau einer Stunde muss er die Stelle<br />
verlassen. Durch die Gier kommt er nicht rechtzeitig heraus und muss hundert<br />
Jahre im Berg bleiben.<br />
Ein weiteres Beispiel erzählt von einem Raubritter, der seine verborgenen Schätze<br />
unter seiner Burg versteckt hält und deshalb sieht man dort in der Johannisnacht<br />
hin- und her huschende Lichter.<br />
Diese Geschichten gleichen Inhalts, aber an jeweils andern Orten handelnd,<br />
finden wir im gesamten deutschsprachigen, ja europäischen Raum wieder. Dabei<br />
wurden sie wie selbstverständlich mit den jeweiligen regionalen oder dörflichen<br />
Besonderheiten verknüpft, z.B. mit den heimischen Bergen, Burgen, Höhlen oder<br />
Mühlen.<br />
So nahm man früher beim Dienstbotenwechsel als Magd oder Knecht die<br />
einheimischen Sagen und Geschichten mit und passte sie an die Burgruine oder<br />
dem Berg in der neuen Heimat an. Außerdem wechselten Sagen aus anderen<br />
Regionen durch Handwerksburschen, umherziehenden Korbmacher und Flößer.<br />
So entstanden viele Wandersagen, deren Ursprungsorte nur noch selten zu finden<br />
sind.<br />
Wetterregeln um dem Johannistag<br />
„Das Wetter am Siebenschläfer-Tag noch sieben Wochen bleiben mag.“<br />
Die sehr eingängige Siebenschläfer-Regel (27. Juni) ist auch heute noch eine<br />
der bekanntesten Bauernregeln in Deutschland. Im Büchlein „Bauernregeln<br />
– ihre Deutung aus meteorologischer Sicht“ wird eine Genauigkeit von zwei<br />
In eigener SerieSache<br />
auf drei Fälle beschrieben: „Legt man den Wetterverlauf um den 27. Juni<br />
zugrunde, so werden mit 61 Prozent Wahrscheinlichkeit die sieben Folgewochen<br />
ebenso ausfallen. Tatsächlich ist es so, dass Ende Juni / Anfang Juli in den<br />
mitteleuropäischen Breitengraden meist die Entscheidung darüber fällt, ob der<br />
Sommer gut oder schlecht wird. Die Wissenschaft bemerkt dazu, dass sich häufig<br />
um die Sommersonnenwende Wetterumschläge anbahnen, die dann meist von<br />
längerer Dauer sind. Oft wurden die Bauern- oder Wetterregeln angesichts der<br />
modernen Meteorologie und ihrer Möglichkeiten als “Märchen” abgetan.<br />
Tatsächlich hat der Berliner Meteorologe Horst Mahlberg über 400 der<br />
Bauernregeln in langen Forschungsreihen ernsthaft untersucht und mit<br />
Wetterdaten der letzten 80 Jahre verglichen. Sein Ergebnis: Sie treffen in zwei von<br />
drei Fällen zu. Er sagte dazu: „Ich kann nur sagen: Hut ab vor der hervorragenden<br />
Beobachtungsgabe unserer Vorfahren. Wir können da heute sehr viel lernen, und<br />
die meisten Bauernregeln haben eine sehr, sehr gute Substanz.”<br />
Zum Schluss darf „Peter und Paul“(29.) nicht vergessen werden. Ältere Mitbürger<br />
können sich noch daran erinnern, dass an diesem Tag in Deutschland ein<br />
katholischer Feiertag war. Im Garten werden um diese Zeit frische Erdbeeren und<br />
in den Obstgärten Kirschen geerntet. Sollte allerdings eine Regenzeit die Ernte<br />
verzögern muss mit großen Erteeinbußen gerechnet werden. Nicht umsonst sagt<br />
ein Spruch: „An Peter und Paul werden die Kirschen faul!“<br />
Juni-Düfte und Frau Holle<br />
Kommen wir zum Abschluss noch zu den Düften um dem Johannitag.<br />
Neben den Düften der verschiedenen Rosensorten dominiert im Juni der Geruch<br />
der Holunderblüten. Im Juni lässt sie es schneien, die Frau Holle, wenn sie<br />
ihre Kissen ausschüttelt. Es ist allerdings nicht Schnee, welchen wir mit dem<br />
bekannten Märchen der Brüder Grimm in Verbindung bringen, sondern die<br />
Doldenrispen am Hollerbusch, in dem sie wohnt. Sie, die germanische Holla,<br />
strenge und gleichzeitig hilfreiche Schutzgeistin für Haus und Hof, gab dem<br />
Holunder möglicherweise den Namen, vielleicht aber auch umgekehrt. Holunder<br />
leitet sich vom althochdeutschen „holuntar“ ab. Wie der Wacholder enthält es<br />
die Nachsilbe „der“, manchmal auch „dra“ oder „dre“, was bei den Germanen<br />
„Baum“ bedeutete. Im englischen „tree“ für Baum klingt es ebenfalls nach.<br />
„Vor dem Holler muss man den Hut ziehen“, sagt eine alte Weisheit. Das „heilige<br />
Gehölz“, wie es in alten Quellen tituliert wird, verwendeten die Vorfahren als<br />
vielseitige Nutzpflanze: Blüten und Beeren als Grundlagen für die Medizin<br />
sowie für Speis und Trank, das Holz für Musikinstrumente und die Früchte zum<br />
Färben. Außerdem hatte man großen Respekt vor dem „zähen Holler“, denn<br />
er galt als unverwüstlich und wuchs überall. Auch für den Naturschutz ist der<br />
Holunder ein „heiliges Gehölz“. Seine Früchte und die Holunderblattlaus bilden<br />
ein Nahrungsnetz für 62 Vogelarten.<br />
Andreas Motschmann<br />
2/2011 40 Käseblatt<br />
Käseblatt 41<br />
2/2011