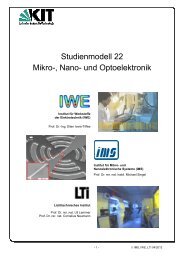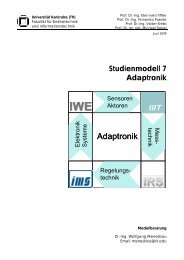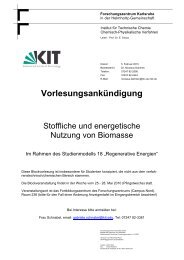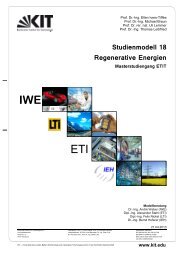Stabilität von Sr(Ti0.65,Fe0.35)O3-δ - am IWE
Stabilität von Sr(Ti0.65,Fe0.35)O3-δ - am IWE
Stabilität von Sr(Ti0.65,Fe0.35)O3-δ - am IWE
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
50 4 Diskussion<br />
zu einer erhöhten Ladungsträgergeneration (n-Leitung) und somit zu einem Anstieg der Leitfähigkeit<br />
kommen müsste. Dieses Abweichen <strong>von</strong> der theoretischen Kurve weist auf eine Instabilität<br />
des Materials hin. Die Instabilität steigt mit zunehmender Dauer (Bild 4-11, „Instabilität<br />
I, II“).<br />
Korngrenzen haben auf die Leitfähigkeit in Metalloxiden einen großen Einfluss. Häufig behindern<br />
Korngrenzen den Transport <strong>von</strong> Ladungen und Ionen; der Korngrenzwiderstand wird<br />
durch eine Raumladungszone verursacht, in der sich keine freien Ladungen befinden. Deshalb<br />
wird vermutet, dass sich die Korngrenzen <strong>von</strong> STF ändern und somit die elektrische Instabilität<br />
verursachen.<br />
Souza [34] setzt für eine Korngrenze in eisendotiertem <strong>Sr</strong>TiO 3 zwei Schottky-Übergänge als<br />
Modell an. Die Grenzfläche ist in diesem Modell positiv geladen, was zu einer Verarmung<br />
<strong>von</strong> Sauerstoffleerstellen und Löchern in den Körnern führt. Die positive Korngrenze wird<br />
also durch eine negative Raumladungszone der unbeweglichen, negativ geladenen Eisenionen<br />
Fe′<br />
Ti<br />
kompensiert. Mit der Poissongleichung lässt sich der Potentialverlauf über eine Korngrenze<br />
errechnen (für die mathematische Ausführung siehe [34]). Für Ladungsträger stellt<br />
dieser Potentialverlauf eine Barriere dar. Mit zunehmender Reduzierung steigt diese Barriere<br />
an, so dass der Widerstand der Probe steigt bzw. die Leitfähigkeit sinkt.<br />
Ein Widerstandsanstieg wurde auch bei den Untersuchungen zur elektrischen Impedanz festgestellt<br />
(Anhang II). Da die Messungen bei 100 °C durchgeführt wurden, lag bereits der Ausgangswiderstand<br />
mit ca. 10 kΩ deutlich über dem Ausgangswiderstand des Leitfähigkeitsmessplatzes<br />
(10 Ω, 900 °C). Nach der Alterung (Versuch 8, S. 18) erhöhte sich der Widerstandswert<br />
um mehrere Dekaden (die Proben waren weitgehend isolierend), während sich der<br />
Widerstand während der Alterung im Leitfähigkeitsmessplatz maximal verdoppelte.<br />
Die starke Temperaturabhängigkeit der Widerstandsänderung spricht ebenfalls für eine Veränderung<br />
der Korngrenzen. Bei einer hohen Temperatur <strong>von</strong> 900 °C überwinden die Ladungsträger<br />
die Potentialbarriere leichter als bei der niedrigen Temperatur <strong>von</strong> 100 °C.<br />
Der starke Widerstandsanstieg nach 128 h in Bild 4-11 ist auf Rissbildung in der Probe zurückzuführen.<br />
Die Risse entstanden nach einer T-Variation <strong>von</strong> 900 auf 850 °C.