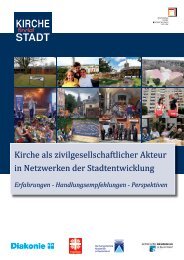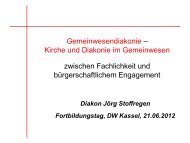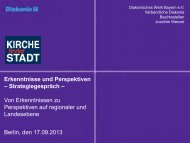Kirche mitten drin« Sozialer, struktureller und ... - Kirche findet Stadt
Kirche mitten drin« Sozialer, struktureller und ... - Kirche findet Stadt
Kirche mitten drin« Sozialer, struktureller und ... - Kirche findet Stadt
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
epd-Dokumentation 10/2013 11<br />
Kommune <strong>und</strong> <strong>Kirche</strong>ngemeinde in polarisierter <strong>Stadt</strong><strong>und</strong><br />
Regionalentwicklung<br />
Von Prof. Dr. Albrecht Göschel<br />
»<strong>Kirche</strong> <strong>mitten</strong> drin« – <strong>Sozialer</strong>, <strong>struktureller</strong><br />
<strong>und</strong> demographischer Wandel in Städten <strong>und</strong><br />
Gemeinden – die Herausforderung für <strong>Kirche</strong>,<br />
ihre Diakonie <strong>und</strong> Zivilgesellschaft vor Ort,<br />
Evangelische Akademie Meißen, 1.– 2.11. 2012<br />
1. Sozialstrukturelle <strong>und</strong> territoriale<br />
Polarisierung<br />
Bereits zu Beginn der 1990er-Jahre, also unmittelbar<br />
nach der deutschen Vereinigung, sieht Ralf<br />
Dahrendorf das Ende des »sozialdemokratischen<br />
Konsenses« kommen (Dahrendorf.1995). Dieser<br />
Konsens, der mehr oder weniger alle relevanten<br />
politischen Parteien <strong>und</strong> Gruppierungen Deutschlands<br />
umfasst, basiert auf der Priorität von »sozialer<br />
Gleichheit«, <strong>und</strong> sei es in der Form von<br />
Chancengleichheit, als dem dominierenden innenpolitischen<br />
Ziel. Mit dem Sozialstaatspostulat<br />
des Gr<strong>und</strong>gesetzes ist die Basis dieses Konsenses<br />
gelegt, der jedoch das gesamte kurze »sozialdemokratische<br />
Jahrh<strong>und</strong>ert« von etwa 1920 bis in<br />
die 1980er-Jahre bestimmt. Dieses Ziel einer materiellen<br />
Gleichheit durch Umverteilung <strong>und</strong> einer<br />
Chancengleichheit durch ausgeglichene Infrastrukturversorgung<br />
in allen Regionen des Nationalstaates<br />
verliert nach Dahrendorf seine Attraktivität<br />
<strong>und</strong> Aktualität zum einen durch eine historisch<br />
einmalige Annäherung an dieses Ziel. Realisierungen<br />
derartiger Ziel mindern ihre Anziehungskraft,<br />
da hinter dann auch die negativen<br />
Begleiterscheinungen deutlich werden <strong>und</strong> den<br />
utopischen Schwung bremsen. Zum anderen<br />
scheinen aber auch kaum überwindliche Hindernisse<br />
gegen eine weitere Annäherung an eine<br />
solche Zielsetzung zu entstehen. An die Stelle<br />
von »Gleichheit« als Norm <strong>und</strong> Faktum treten<br />
damit zum einen normative Aufwertungen <strong>und</strong><br />
Rechtfertigungen von Ungleichheiten, zum anderen<br />
vergrößert sich faktisch überw<strong>und</strong>en geglaubte<br />
Ungleichheit.<br />
Es entstehen neue Ungleichheiten, die bei einer<br />
Zuspitzung die Form von Polarisierungen annehmen<br />
können, in denen also die Extreme, z.B.<br />
der Einkommen gesteigert, Mittellagen eher reduziert<br />
werden. Die so genannte »Einkommensschere«<br />
öffnet sich <strong>und</strong> vergrößert sowohl die Gruppe<br />
der Gut- als auch die der Schlechtverdienenden,<br />
während die Gruppe der mittleren Einkommen<br />
reduziert wird. Das soll der Begriff der Polarisierung<br />
andeuten, eine Entwicklung von Extremlagen<br />
bei Ausdünnung einer verbindenden, Kontinuität<br />
sichernden Mitte. Die regelmäßig erscheinenden<br />
»Reichtums- <strong>und</strong> Armutsberichte« der<br />
B<strong>und</strong>esregierung belegen, dass in Bezug auf Einkommen<br />
diese Entwicklung, die inzwischen als<br />
Bedrohung des sozialen Friedens gewertet wird,<br />
in Deutschland in vollem Gange ist. Die Einkommen<br />
der oberen Gruppe von Einkommensbeziehern<br />
erhöhen sich <strong>und</strong> diese Gruppe wächst,<br />
während gleichzeitig die unteren Einkommen<br />
stagnieren oder gar sinken, auch diese Gruppe<br />
sich aber vergrößert.<br />
Derartige Polarisierungen bilden sich auch räumlich<br />
in wachsenden Ungleichheiten, in Disparitäten<br />
ab. <strong>Stadt</strong>teilen oder ganzen Regionen mit<br />
einer überwiegend einkommensschwachen Bevölkerung<br />
stehen solche mit durchschnittlich<br />
hohen Einkommen gegenüber. Die Differenzen in<br />
den durchschnittlichen Einkommen werden auf<br />
räumlicher, territorialer Ebene nicht nur ergänzt<br />
sondern verstärkt durch Wanderungsbewegungen<br />
von den eher schwächeren in die stärkeren Bereiche.<br />
Auf städtischer Ebene finden sich verständlicher<br />
Weise auch Gegenbewegungen von den eher<br />
starken, zumindest von mittleren Räumen in die<br />
schwächeren, wenn soziale Abstiege das erzwingen.<br />
Vertiefen sich die Unterschiede zwischen<br />
den entsprechenden Teilräumen, sei es einer<br />
<strong>Stadt</strong>, sei es einer Region oder eines Nationalstaates,<br />
wird auch hier von einer Polarisierung gesprochen,<br />
<strong>und</strong> verfügbare Daten legen nahe, dass<br />
in Deutschland entsprechende Prozesse ablaufen,<br />
<strong>und</strong> dies, obwohl mit in dem Postulat von der<br />
Gleichheit oder zumindest Gleichwertigkeit der<br />
Lebensbedingungen innerhalb des Nationalstaates<br />
als raumordnungspolitische Umsetzung des Sozialstaatsgebotes<br />
eine Verfassungsnorm formuliert<br />
ist, die derartigen Entwicklungen entgegen steht.