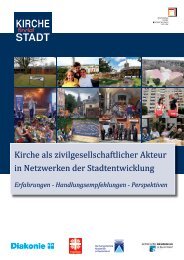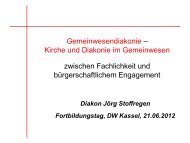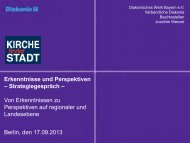Kirche mitten drin« Sozialer, struktureller und ... - Kirche findet Stadt
Kirche mitten drin« Sozialer, struktureller und ... - Kirche findet Stadt
Kirche mitten drin« Sozialer, struktureller und ... - Kirche findet Stadt
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
12 10/2013 epd-Dokumentation<br />
2. Ursachen des Wandels<br />
Es gilt als gesichert, dass der Wandel Deutschlands<br />
von einem an Gleichheitsprinzipien orientierten<br />
zu einem zunehmend von Ungleichheit<br />
bestimmten Land von eine Reihe so genannter<br />
»Megatrends« ausgelöst wird. Die Bezeichnung<br />
»Megatrend« soll andeuten, dass derartige Entwicklungen<br />
politisch kaum zu beeinflussen sind,<br />
dass sie sich also einer gezielten Steuerung entziehen,<br />
auch wenn sie möglicherweise durch<br />
politische (Fehl-)Entscheidungen ausgelöst worden<br />
sind. Megatrends wirken eher als Rahmenbedingungen<br />
aktueller Politik, als Herausforderungen,<br />
auf die politisch reagiert werden muss, nicht<br />
als Phänomene, denen in überschaubarer Zeit<br />
entscheidend entgegen gearbeitet werden könnte.<br />
Nur stichwortartig, ohne jeden Anspruch auf<br />
Vollständigkeit, könnte man zumindest vier derartige<br />
Trends unterscheiden, die die Entwicklung<br />
zu sozial<strong>struktureller</strong> <strong>und</strong> territorialer Ungleichheit<br />
fördern <strong>und</strong> die zurzeit ablaufen, ohne entscheidend<br />
steuerbar zu sein.<br />
Globalisierung: Die internationale, tendenziell<br />
globale Möglichkeit der Verlagerung von Arbeitsplätzen<br />
<strong>und</strong> Kapital reduziert die nationalstaatliche<br />
Autonomie <strong>und</strong> schränkt vor allem die nach wie<br />
vor komplett nationalstaatliche Sozialpolitik ein.<br />
Demographie: Die aktuelle Bevölkerungsentwicklung<br />
aus Geburtenrückgang, Alterung <strong>und</strong> Migration<br />
führt zu Belastungen der Sozialsysteme, vor<br />
allem des Renten- <strong>und</strong> des Ges<strong>und</strong>heitssystems,<br />
die vermutlich zu wachsender Ungleichheit führen<br />
werden. Vor allem ist mit einer wachsenden<br />
oder wieder zurückkehrenden Altersarmut zu<br />
rechnen.<br />
Dienstleistungsgesellschaft: Der Übergang zur<br />
Dienstleistungsgesellschaft schwächt vermutlich<br />
alle so genannten »Großsysteme« des Arbeitslebens<br />
<strong>und</strong> der sozialen Sicherung <strong>und</strong> setzt an die<br />
Stelle von deren Vereinheitlichungs- <strong>und</strong> Gleichheitstendenzen<br />
solche der Differenzierung, der<br />
Betonung von Unterschieden, der Flexibilität <strong>und</strong><br />
des persönlichen oder individuellen Risikos. An<br />
die Stelle weitgehend gesicherter <strong>und</strong> stabiler<br />
Berufsbiographien treten wachsende Zahlen tendenziell<br />
prekärer biographischer Verläufe, die<br />
sich auch dann, wenn gute, qualifizierte Ausbildung<br />
immer noch den besten Schutz vor sozialem<br />
Abstieg oder Verarmung bieten, bis in die Mittelschichten<br />
oder zu den Akademikern reichen können.<br />
Insgesamt wachsen mit diesem Übergang<br />
zur Dienstleistungs- <strong>und</strong> Wissensökonomie Ängste<br />
<strong>und</strong> Bedrohungsgefühle, Konkurrenz <strong>und</strong> Arbeitsdruck,<br />
alles unter gegenwärtigen Bedingungen<br />
keine guten Voraussetzungen für übergreifende,<br />
nationale Solidarität oder für die Verfechtung<br />
von Gleichheitsnormen.<br />
Wertewandel: Der Wertewandel, der in Deutschland<br />
in den 1960er-Jahren eingesetzt <strong>und</strong> inzwischen<br />
alle – westdeutschen – Bevölkerungsgruppen<br />
erreicht hat, legt die häufig durchaus berechtigte<br />
Vorstellung nahe, dass der Einzelne für sein<br />
»Schicksal« selbst verantwortlich ist. In einer<br />
Gesellschaft, in der an die Stelle traditioneller<br />
Pflicht- <strong>und</strong> Akzeptanzwerte solche der Selbstverwirklichung<br />
treten, wie es für moderne Gesellschaften<br />
kennzeichnend ist, schwinden die Möglichkeiten,<br />
für individuelle Benachteiligung umfassende<br />
Solidarität beanspruchen zu können, da<br />
die individuelle Lebenslage immer die Folge individuellen<br />
Fehlverhaltens z.B. in Form falscher<br />
Berufsentscheidungen sein kann. So wie Erfolg<br />
<strong>und</strong> Aufstieg werden auch Abstieg <strong>und</strong> Scheitern<br />
<strong>und</strong> deren Folgen von Benachteiligung den Individuen<br />
zugeschrieben <strong>und</strong> nicht als selbstverständliche<br />
Aufforderung zur ausgleichenden Solidarität<br />
verstanden. Ungleichheit wird auf diese<br />
Weise in gewissem, mit Sicherheit wachsendem<br />
Maße gerechtfertigt. Sie wird als angemessen<br />
anerkannt. Zumindest wächst die Toleranz gegenüber<br />
Ungleichheit, wie es bis in die 1970er-<br />
Jahre kaum der Fall war. Gruppen, die am Wertewandel<br />
eher nicht teilgenommen haben, wie<br />
z.B. bestimmte Milieus der neuen B<strong>und</strong>esländer<br />
gelten aus dieser Sicht als rückständig <strong>und</strong> immobil,<br />
die durch diese Verhaltensformen gleichfalls<br />
ihre Benachteiligung selbst verschulden.<br />
Wertewandel beendet nicht humanitäre Einstellungen<br />
von Solidarität <strong>und</strong> Anteilnahme, stellt<br />
aber deren praktische Umsetzung zunehmend in<br />
die Entscheidung des Einzelnen.<br />
Diese Trends, die in der gegenwärtigen Form vermutlich<br />
noch mehrere Jahrzehnte wirksam sein<br />
werden, erschweren zumindest eine Politik der<br />
Gleichheit, wie sie das »sozialdemokratische Jahrh<strong>und</strong>ert«<br />
auszeichnete. Im Rückblick wird sogar<br />
erkennbar, dass die in dieser Zeit erreichte Gleichheit<br />
auf der Basis allgemeinen hohen Wohlstandes<br />
möglicherweise eine extreme historische Ausnahmesituation<br />
dargestellt haben könnte. Das würde<br />
bedeuten, das Deutschland mit seiner Entwicklung<br />
zu mehr Ungleichheit sich eher wieder einer historischen<br />
Normalität annähert, als dass sich hier eine<br />
extrem ungewöhnliche Ausnahmesituation herausbilden<br />
würde. Zumindest sind in allen anderen